Heinrich Steinfest: „Ich möchte leben wie ein Wombat“

Reisen sollte man lieber mit dem Kopf als mit dem Flugzeug: Gespräche mit Heinrich Steinfest sind wie seine Bücher – ständig biegt er überraschend zu einem anderen Thema ab. Der neueste Krimi des 62-jährigen Autors führt die Ermittler Cheng und Frau Wolf in die ursprüngliche Heimat von Steinfest, nach Australien. Ein Gespräch über Wombats, Wien, die Klimabewegung und die Frage, ob Künstliche Intelligenz auch für ihn zur Konkurrenz werden könnte.
KURIER: Beim vierten und fünften Chengbuch hieß es, diese seien die letzten. Nun erscheint das siebente. Werden wir noch zweistellig?
Heinrich Steinfest: Ja, das ist peinlich, ich weiß. Es ist aber wirklich nicht so durchtrieben, wie es wirkt. Bereits beim ersten Cheng hatte ich nicht gedacht, dass dem ein zweiter folgen wird. Und nach dem dritten – auch, weil ich ein Freund von Trilogien und Triptychen bin – sollte ernsthaft Schluss sein. Nicht zuletzt, weil da Chengs Hund bereits tot war. Aber die Leute auf Lesungen von all den Nicht-Cheng-Romanen der folgenden Jahre haben sich immer wieder nach dem einarmigen Detektiv und vor allem seinem Hund erkundigt und auf meinen Hinweis, dessen Hund sei doch tot, mit einem „Egal!“ reagiert. Letztlich ist der ganze Cheng weniger eine Serie, als ein „Begleiter“ meines eigenen Lebens, mit mir gealtert, ein Trabant um all die anderen Romane herum, die ich in diesen Jahren geschrieben habe.
Das Buch führt nach Australien, wo Sie geboren sind. Welche besondere Erinnerung haben Sie noch an Down Under?
Keine. Ich war Kleinkind, als meine Eltern, Auswanderer aus Österreich, Australien verließen und nach Wien zurückkehrten. Zugleich ist ja bekannt, wie prägend die ersten Lebensjahre sind. Mein Australien liegt tief gesenkt im Unterbewusstsein. Ein Gefühl. Ein australisches Gefühl. So ein gewisser Geruch. Und eine gewisse Hitze. Eine Wallung.
Ist das Buch vielleicht auch eine Verarbeitung von Fern- oder Heimweh?
Ich selbst bin ein bekennender Reisehasser und eigentlich gilt das auch für meine Figuren. Die ich aber dennoch immer wieder um die Welt schicke. Es liegt darin sicher eine Zerrissenheit, fort zu wollen, aber eigentlich viel lieber zu Hause zu bleiben. Dieses Reisen aus Lust oder Not ist genau genommen eine Perversion. Unnötig, gefährlich, schädlich. Wir sollten nur in Büchern und Filmen reisen, das sollte reichen. Wobei ich natürlich weiß, wie sehr Flucht und Not ein „Reisen“ bedingen. Jegliche Form von Flucht. Pervers bleibt es trotzdem.

Wombat
In Ihrem aktuellen Buch geht es um einen verschwundenen Wombatforscher, ein Wombat spielt außerdem eine wesentliche Rolle – wie kamen Sie ausgerechnet auf dieses Tier?
Weil es mich anspricht. Eine originelle Kreatur. Die Mischung aus Friedlichkeit und Wehrhaftigkeit – eingedenk eines gepanzerten Hinterteils. Eines dieser Geschöpfe, bei denen ich mir denke, so möchte ich auch leben.
Die Wombats sind sehr akkurat beschrieben. Während der Wiener Zoo Schönbrunn an der Haltung eines Wombats klaglos scheitert, gibt es zumindest welche in Hannover. Haben Sie diese schon besucht? Oder haben Sie irgendwelche andere Form der Wombatforschung betrieben?
Ja, in Hannover war ich. Ich selbst bin kein Wombatforscher, aber habe mich natürlich für diesen Roman eingehend damit beschäftigt, nicht zuletzt mit dem faszinierenden Umstand, dass diese Tiere quadratischen Kot produzieren und den damit verbundenen diversen Spekulationen. Wie heißt es im Roman? The truly beautiful meaning of square shit.
Hätten Sie gerne ein Wombat als Haustier?
Nein, meine Haustierzeit ist mittlerweile vorbei. Zudem war ich immer ein Katzenmensch. Allerdings hat meine Frau eine wirklich uralte, möglicherweise unsterbliche Rennmaus namens Kafka, der ich hin und wieder einen schönen Haufen Pinienkerne serviere.
Die Wiener Krimiautorin Mina Albich schreibt vergleichbar lange Krimis jeweils in 30 Tagen. Sie sind auch eher ein Schnellschreiber. Wäre für Sie so etwas denkbar?
Schnellschreiber schon, aber auch Langschreiber. In dreißig Tagen krieg ich eher einen umfangreichen Anfang hin. Ich brauch schon mein halbes Jahr für so ein Roman-Ding.
Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Glauben Sie, dass ein Computer ein besseres Buch schreiben könnte als Sie?
So verrückt ist kein Computer.
Sie sind vor Jahren von Wien weggezogen? Warum eigentlich?
Das hatte private Gründe, war Schicksal und hat mir die Möglichkeit gegeben, Wien und Österreich aus der Vogelperspektive zu betrachten. Beziehungsweise wie ein Vogel, der auf sein Nest zurücksieht.
Und warum kommt Wien dennoch immer wieder prominent vor in Ihren Büchern?
Ich zitiere in diesem Zusammenhang gerne den von mir so geschätzten Heimito von Doderer, der meinte, dass jeder seine Kindheit über den Kopf gestülpt bekommt wie einen Eimer. „Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln wie er will.“ Also, Wien und die österreichische Literatur, das ist die Sauce, die an mit herunterrinnt. Unabwaschbar.
Fühlen Sie sich eher als Australier, Österreicher oder Deutscher? Oder gar als Weltbürger?
Als ein Wiener in Deutschland.
Sie waren als prominenter Gegner des umstrittenen Bahnhofprojekts Stuttgart21 in der ersten Reihe aktiv, engagieren Sie sich auch in der Klimabewegung?
Ich war auch früh in Hainburg dabei, damals mit dünnem Cordsakko und kleiner lederner Aktentasche als der wahrscheinlich am schlechtesten ausgerüstete Aktivist aller Zeiten. In die Stuttgart-Bewegung wiederum bin ich unversehens hineingerutscht, habe aber erkannt, wie recht die Leute mit ihrem Protest hatten. Zugleich ist mir klar geworden, wie wenig mir das liegt, in dieser Weise eine öffentliche Figur zu sein. Ich bin einfach am liebsten am Schreibtisch und im Kosmos des Erfundenen und Imaginierten. Aber wenn Sie mich nach meiner Haltung fragen, kann ich nur antworten, dass ich einzig in der Reduktion – in einem genussvollen Verzicht – Erlösung und Rettung erkennen kann. Ich muss aber auch gestehen, dass ich dann vielleicht etwas weniger Bücher schreiben sollte.
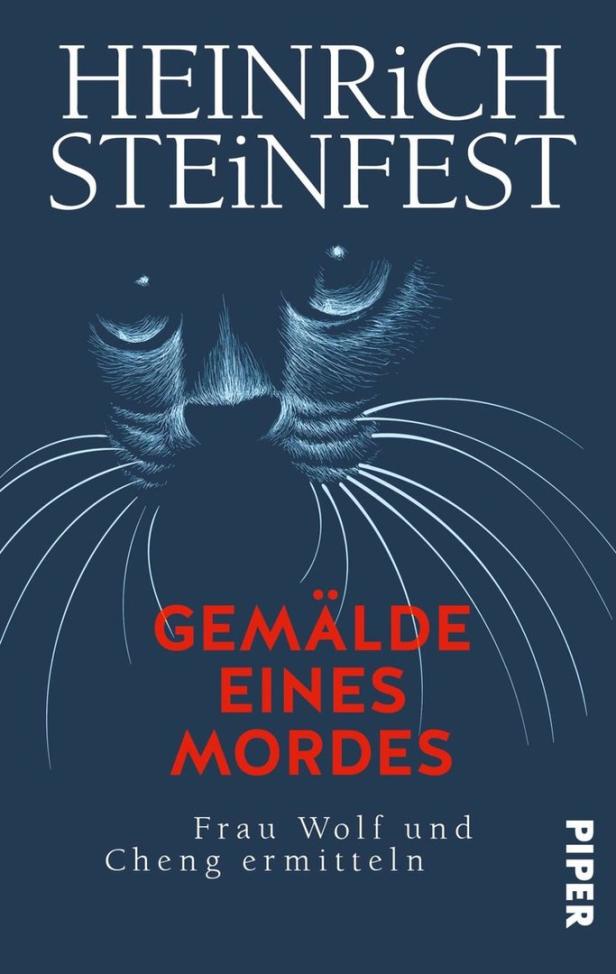
Chengs siebenter Fall
Reisen ist pervers, meint Heinrich Steinfest. Und wer seine Bücher liest, begibt sich mit ihm auf eine perverse Reise – wobei damit im positiven Sinne „anders“ gemeint ist.
Weder der Titel noch das Titelfoto haben irgendwie mit dem Krimi zu tun. Und natürlich kann man sich fragen, ob man wirklich auf einer ganzen Seite schildern muss, wie ein Auto einen Vogel anfährt.
Chengs siebenter Fall ("Gemälde eines Mordes") spielt in Australien, Österreich und Deutschland und er ist kein klassischer Krimi, sondern einer mit etlichen teils skurrilen Wendungen. Alles beginnt mit der Suche nach dem vermissten Wiener Wombatforscher Oliver Roschek.
Dabei wird sich das Blatt gleich mehrfach wenden. Man kann einfach nicht glauben, was alles in einem Wombat oder einem Tischtennistisch versteckt werden kann. Und welche Geheimnisse Lottogewinner verbergen können.






Kommentare