Lebertransplantation bei Kindern: Warum meist Eltern die Spender sind
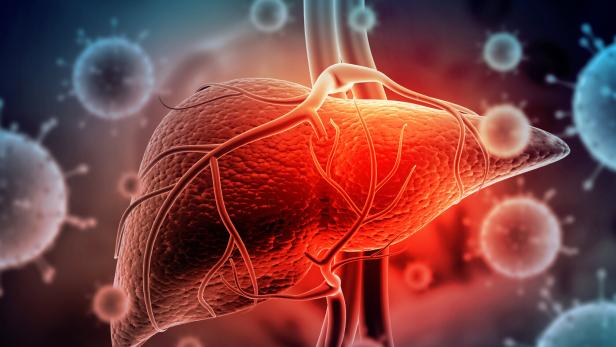
Es gibt fünf verschiedene Arten von Hepatitis: Gefährlich sind vor allem Hepatitis B und C, die zu den Hauptursachen von Leberzirrhose und Leberkrebs zählen.
Rund 200 Fälle von Kindern mit einer Hepatitis-Infektion unklarer Ursache sind bisher weltweit bekannt. Als Ursache diskutiert werden Infektionen mit Adeno- und/oder Coronaviren – der KURIER berichtete. Donnerstag wurde die erste Erkrankung aus Deutschland gemeldet. In Österreich sind weiterhin nur die Erkrankungen der zwei Kinder im St. Anna Kinderspital bestätigt, ihr Zustand ist stabil. 17 Kinder weltweit benötigten bisher deshalb eine Lebertransplantation. Sollte auch in Österreich eine Lebertransplantation bei einem Kind notwendig werden, würde diese am Transplantationszentrum der MedUni Innsbruck durchgeführt werden. Aber auch schon bisher gab es regelmäßig Lebertransplantationen bei Kindern.
„Bisher gab es im Schnitt rund zehn Lebertransplantationen bei Kindern jährlich“, sagt der Kinderarzt Thomas Müller, Leiter der Innsbrucker Uni-Kinderklinik. Der Hauptgrund für ein akutes Leberversagen bei Kindern ab zirka fünf Jahren waren bisher genetische Stoffwechselerkrankungen, am häufigsten dabei die „Kupferspeicherkrankheit“ (Morbus Wilson). Bei dieser kommt es aufgrund einer Genmutation zu einer verminderten Ausscheidung von Kupfer, das sich u. a. in der Leber anreichert und diese schädigt." Die Folge davon ist schließlich eine Hepatitis, eine chronische Entzündung, die zu einer Vernarbung von Lebergewebe - einer Leberzirrhose - führt."
Diese Erkrankung tritt nur dann auf, wenn sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits jeweils das mutierte Gen weitervererbt wird.
„Die Kupferspeicherkrankheit nimmt oft einen schleichenden Verlauf mit einer kontinuierlichen Schädigung von Leberzellen, ohne dass es auffällt“, sagt Müller. „Damit kann man lange leben, ohne dass es auffällt. Die Leber kann das lange kompensieren, ausgleichen, bis ein harmloser Infekt – etwa eine Erkältung – zum akuten Leberversagen führt.“ Bei frühzeitiger Diagnose ist eine – lebenslange – medikamentöse Therapie möglich, im schlimmsten Fall muss sehr rasch eine Transplantation durchgeführt werden.
„Es gibt aber wenig Spenderlebern von Kindern, weil – natürlich zum Glück – wenige Kinder einen Unfall haben und auf der Intensivstation versterben. Deshalb hat sich bei den Kindern die Lebendspende sehr bewährt.“
Zumeist ist es ein Elternteil, der den linken Leberlappen spendet.
„Voraussetzung ist, dass der Eingriff den Spender nicht gesundheitlich gefährdet und dieser entweder die Blutgruppe 0 oder die Blutgruppe des Kindes hat. Zwei Transplantationsteams arbeiten dann zeitgleich in zwei nebeneinanderliegenden Operationssälen: „Ein Team entnimmt die kranke Leber des Kindes, und das zweite Team entnimmt den linken Leberlappen und setzt ihn dem Kind ein.“ Eine Lebendspende ist innerhalb von 24 Stunden möglich, die Ergebnisse sind sehr gut.
Die transplantierten Kinder mit Morbus Wilson sind im Schnitt zehn Jahre alt.

Untersuchung der Leber: Nach genauer Abklärung können Eltern einen Teil ihres Organs spenden.
Bei Kleinkindern (sechs Monate bis zwei Jahre) sind sehr selten Lebertransplantationen wegen eines chronischen Leberversagens notwendig: Eine Fehlbildung der Gallengänge lässt die Galle nicht abfließen, Leberzellen werden geschädigt.
Hepatitis-Viren selbst (Hepatitis A, B, C, D, E) führen selten zu einem akuten Leberversagen, betont Müller: "Am häufigsten tritt das bei einer Infektion mit Hepatitis B auf, aber dagegen sind die allermeisten Kinder geimpft. Und bei den anderen Hepatitis-Viren kommt es extrem selten vor, dass eine Infektion bei gesunden Kindern zu einem Leberversagen führt."
Äußerst selten ist in Österreich - im Gegensatz etwa zu den USA - auch ein Leberversagen bei Kindern durch eine Überdosierung des fiebersenkenden Wirkstoffs Paracetamol.
Müller betont, dass man bei einer Gelbsucht unbedingt alle bekannten Ursachen abklären muss, ehe man von einer unklaren Ursache spricht und an einen möglichen Zusammenhang mit Adeno- oder Coronaviren denkt. "Es wäre furchtbar, wenn man jetzt aufgrund der hohen Aufmerksamkeit für einen möglichen Zusammenhang mit Adeno- oder Coronaviren einen Morbus Wilson übersieht, der bei frühzeitiger Diagnose gut medikamentös behandlet werden kann."
Überreaktion des Immunsystems?
Was die Erforschung der neuen Fälle mit unklarer Ursache betrifft, mehren sich mittlerweile Berichte, wonach es sich nicht um eine Folge einer akuten Infektion mit Adeno- oder Coronaviren handeln könnte, sondern um eine überschießende Reaktion des Immunsystems in den Wochen bzw. Monaten nach der Infektion.
So konnten israelische Forscherinnen und Forscher nachweisen, dass bei allen 12 Kindern mit Hepatitis-Erkrankungen unklarer Ursache rund dreieinhalb Monate davor einen Coronavirus-Infektion stattgefunden hatte. Noch sei es aber zu früh um behaupten zu können, dass es sich um ein Post-Covid-Phänomen handle, betonten Forscher in der israelischen Tageszeitung Haaretz.
Auch Thomas Müller kann dieser Hypothese einer Reaktion des Immunsystems etwas abgewinnen: "Die meisten Infektionen der vergangenen Monate waren ja nicht Adenovirus-Infektionen, sondern Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Davon waren ja besonders viele Kinder betroffen." Möglicherweise könnte es genetische Faktoren geben, die eben manche Kinder empfänglich für eine heftige Entzündungsreaktion als Folge einer Infektion mit Coronaviren, Adenoviren oder beiden gemeinsam macht: "Bewiesen ist das aber noch nicht."
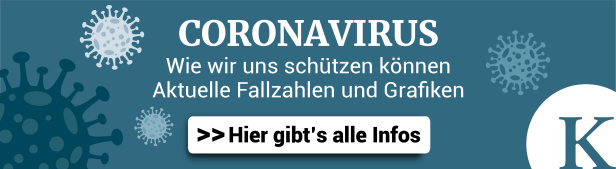





Kommentare