Ärzte über New York, Paris, London: "Uns läuft die Zeit davon"

Patientenaufnahme in einem Spital in New York: Beatmungsgeräte reichen nur noch bis Sonntag.
Es sind dramatische Vergleiche und Worte, die der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio verwendet: „Der kommende Sonntag wird der D-Day.“ Damit wird normalerweise der Zeitpunkt einer größeren militärischen Operation bezeichnet, besonders der 6. Juni 1944, als während des Zweiten Weltkriegs die Landung der Alliierten in der Normandie begann. Und der Bürgermeister warnt: Wenn nicht bald mehr Beatmungsgeräte und mehr medizinisches Personal zur Verfügung stehen, würden Tausende Menschen an den Folgen ihrer Infektion mit dem neuen Coronavirus sterben.
Er habe auch mit Präsident Trump gesprochen, dass New York unverzüglich 2.500 bis 3.000 Beatmungsgeräte benötige und die volle Mobilisierung des Militärs notwendig sei. Die verfügbaren Maschinen reichen nur mehr bis Sonntag. Bill de Blasio rät auch allen New Yorkern, Gesichtsmasken zu tragen.
Schauplatzwechsel: Frankreich ist das Land, in dem das Virus erstmals in Europa auftrat und das den ersten Todesfall außerhalb Asiens zu verzeichnen hatte. Ende dieser Woche bestätigten die Behörden 880 Tote in Altersheimen, weitere 4.500 in den Krankenhäusern. Aber: Die Zahl der täglich neu gemeldeten Todesfälle ist zumindest leicht rückläufig.
Das Vereinigte Königreich verzeichnete von Donnerstag auf Freitag den bisher höchsten Tagesanstieg bei den Todesfällen – um 684 auf insgesamt jetzt 3.605. Und der mit dem Coronavirus infizierte britische Premier Boris Johnson muss seine Selbstisolation in seiner Dienstwohnung in der Downing Street verlängern: Er fühle sich zwar besser, habe aber noch – seit mehr als einer Woche – Fieber.
Es gibt auch Hoffnung
Mittlerweile soll bereits die Hälfte der Weltbevölkerung – knapp vier Milliarden Menschen – wegen der Ausbreitung des Virus zu Hause bleiben. Doch so angespannt die Lage vielerorts auch ist: Der KURIER sprach mit österreichischen Medizinern, die die Situation in den drei Städten durch Aufenthalte und enge Kontakte sehr gut kennen oder – im Falle von Peter Kotanko in New York – derzeit dort arbeiten.
Die Ärzte zeigen die dramatische Situation, die Engpässe an medizinischer Ausrüstung, an Geräten und an Personal auf. Aber sie schildern auch Zeichen der Hoffnung: vom Zusammenhalt unter den Gesundheitsberufen und in der Bevölkerung, der Selbstlosigkeit vieler Menschen im Gesundheitswesen bis hin zur typisch amerikanischen Stimmung des „Ärmelhochkrempelns“ – und des Sich-nicht-unterkriegen-Lassens.
Lesen Sie nachstehend die Berichte über New York, Paris und London.
USA: "Es mangelt an Schutzausrüstung"
New York. Seine Mitarbeiter sind noch immer hoch motiviert, berichtet Peter Kotanko. Der Internist aus Graz leitet seit zehn Jahren in Manhattan, an der 62. Straße, ein Forschungsinstitut mit vier Dialysestationen für 600 Patienten. „Vor drei Wochen haben wir hier unsere klinischen Studien weitestgehend ruhend gestellt.“ Jetzt ist auch für ihn der Kampf gegen das Coronavirus im Fokus: „Binnen weniger Tage hat mein Team Studienprotokolle entwickelt, bei denen es auch um eine intensive SARS-CoV-2-Testung bei unseren Patienten geht.“
Zudem erzeugt man mit den institutseigenen 3-D-Druckern Masken und Gesichtsschutz, während einige Forscher auch in den Dialysestationen aushelfen. „Da dort eine ganze Reihe von Schwestern und Krankenpflegern erkrankt sind.“
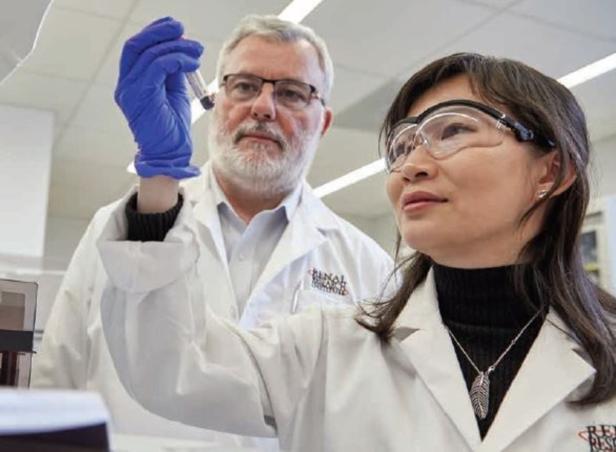
Ein Bild aus besseren Zeiten: Peter Kotanko vor der Coronakrise ohne Schutzmaske.
Kotankos Diagnose für die Stadt fällt weniger positiv aus: Stand 2. 4. sind rund 50.000 Infizierte und 1.560 Tote bestätigt. Mit gemischten Gefühlen beobachtet der Arzt auch, wie im Central Park Zelte zur Betreuung von Patienten errichtet werden: „Es mangelt an Schutzausrüstung und Tests.“ Kollegen von ihm warnen seit Tagen, dass die Kapazitäten in den Spitälern bereits überschritten sind. Laut einer Prognose soll der Höhepunkt der Pandemie in New York State am 10. 4. erreicht werden. Dann könnten bis zu 85.000 Betten und 15.000 Intensivbetten fehlen.
Die prognostizierte Sterblichkeit für Mitte April: 500 bis 1.000 Tote pro Tag. „Es wird intensiv an einer Erhöhung der Kapazitäten gearbeitet. Doch läuft uns langsam die Zeit davon.“ Was ihn auch besorgt: „Das Fehlen einer allgemeinen Krankenversicherung, worunter insbesondere sozial benachteiligte Mitbürger leiden.“
Was ihn hingegen hoffen lässt: „Ich erlebe hier nahezu eine Explosion an Kreativität. Diese ist letztendlich auch die Basis dafür, dass Therapien gefunden werden. Es gibt eine riesige Motivation und eine All-hands-on-deck-Stimmung, die fantastisch ist.“ UM
Frankreich: "Von der Erkrankungswelle überrollt"
Paris. „Die Betroffenheit unter meinen französischen Freunden, die erfahrene Intensivmediziner sind, ist sehr groß. Sie sehen jetzt Dinge, die sie nicht für möglich gehalten hätten.“ Philipp Metnitz leitet die Klinische Abteilung für Allgemeine Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin an der MedUni Graz. Er kennt die Strukturen der Intensivmedizin in Frankreich sehr gut und ist in engem telefonischen Austausch mit dortigen Kollegen. Von 2000 bis 2001 hatte er eine Gastprofessur an der Universität Paris VII (Paris Diderot).
„Frankreich wurde von der Erkrankungswelle überrollt. Im Großraum von Paris sind neun von zehn Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.“ Insgesamt sind es bereits mehr als 6.400 Intensivpatienten in ganz Frankreich. „Laut meinen Kollegen steigt die Zahl weiter an – das ist eine katastrophale Situation. Die Ärzte kämpfen um das Leben jedes Patienten.“ Hinzu komme, dass alleine in Paris bereits mehr als 2.000 Pflegekräfte und Ärzte infiziert seien. „Das kann in den nächsten Tagen zu einem begrenzenden Faktor für die Therapiemöglichkeiten werden“, erläutert der besorgte Intensivmediziner.

Philipp Metnitz: "Große Betroffenheit, aber auch großer Zusammenhalt."
„Frankreich hat sehr kompetente Mediziner, aber die Kapazitäten des Gesundheitssystems sind durch zahlreiche Einsparungen in den vergangenen Jahren deutlich geringer geworden.“ So liege die Anzahl der Intensivbetten pro 100.000 Einwohner nur bei etwa der Hälfte im Vergleich zu Österreich (ca. 29 Betten).
„Gestern hat mir ein ärztlicher Freund erzählt, dass viele ältere Patienten gar nicht mehr auf eine Intensivstation verlegt werden können, weil einfach kein Bett mehr frei ist. Und es gibt auch viele 40- bis 50-Jährige, die in Frankreich von einem schweren Krankheitsverlauf betroffen sind.“ 34 Prozent der Patienten in Intensivbehandlung in Frankreich sind laut neuen Daten jünger als 60 Jahre.
Doch es gebe auch Positives, betont Metnitz: „Was dem gesamten Personal in den Spitälern derzeit Kraft gibt, ist ein sehr starker Zusammenhalt, unter allen Gesundheitsberufen, aber auch innerhalb der gesamten Bevölkerung. Die Solidarität im Land und die gegenseitige Hilfsbereitschaft sind derzeit sehr groß.“ EM
Großbritannien: "Kaum Puffer im Gesundheitssystem"
London. Der Platz in den Leichenhallen der Londoner Spitäler wird langsam knapp. Weiß der österreichische Arzt Manuel Martin. Martin arbeitet derzeit in Genf für „Ärzte ohne Grenzen“, doch er sorgt sich auch um Freunde und Kollegen, die er während seines Studiums von 2012 bis 2018 kennengelernt hat.
Als Student hat er auch miterlebt, wie die konservative britische Regierung „das öffentliche Gesundheitssystem dramatisch unterfinanziert hat“. Das hat dazu geführt, dass schon der Normalbetrieb des National Health Service (NHS) an die Maximalkapazitäten stößt.

Manuel Martin: "Die Kollegen setzen sich trotz des Risikos sehr ein."
Besonders beunruhigt den Arzt, was er von seinen Freunden hört: „Es wird ihnen verboten, über den Mangel an Schutzkleidung und Masken und die kritische Lage in London zu sprechen.“
An sich hat der Österreicher das öffentliche Gesundheitssystem in London trotz der Sparmaßnahmen als extrem effizient und unbürokratisch erlebt. Doch genau das wirkt jetzt wie ein Bumerang: „Es gibt kaum Puffer. Verglichen mit Österreich verfügen die Briten nur über halb so viele Intensivbetten pro Kopf. Das ist bei einer Pandemie, bei der zwei bis fünf Prozent der Erkrankten eine intensive Betreuung benötigen, ein Verhängnis.“
Die aktuelle Stimmung in Genf erlebt er als „beunruhigend und beängstigend. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist die Epidemie schlimmer als in Italien“. Daher sind „Ärzte ohne Grenzen“ inzwischen auch in einem der reichsten Länder der Welt im Einsatz. Martin selbst macht sich Sorgen um jene Menschen, die nicht die Mittel haben, um sich vor Infektionen schützen zu können: „Ich frage mich ganz ehrlich auch, ob ich wieder in die praktische Medizin zurückkehren soll.“
Hoffnung geben ihm auch seine Kollegen, „die sich selbstlos und trotz der Risiken gegen diese Pandemie einsetzen“. Außerdem hätten viele Entscheidungsträger verstanden, dass Medikamente und Impfstoffe für alle leistbar und zugänglich gemacht werden müssten. UM




Kommentare