Die verunsicherten Staaten von Amerika: "Nach der Wahl wird nichts besser"

Es gibt diesen Graben, von dem alle reden. Ein Riss quer durch Amerika, der durch Familien, Büros, Kirchen geht, rechts die Trumpisten, links die Demokraten. Sie schweigen sich gegenseitig beim Thanksgiving-Dinner an, beleidigen einander mitten auf der Straße, heißt es. Oder brechen einfach den Kontakt zueinander ab.
Der Graben ist echt, keine Frage. Doch die wenigsten sitzen wirklich links und rechts, außerhalb davon. Die Mehrheit sitzt mittendrin in diesem Graben. Und zittert.
Warum Trump?
Es ist noch warm in diesem Oktober, doch der Strand ist leer. Nur Kelli sitzt in ihrem Klappsessel, die nackten Füße im Sand. Auf ihrem Handy läuft ein Live-Gottesdienst, sie ist ganz versunken.
Virginia Beach ist nur ein paar Autostunden von Washington entfernt. Hierher kommen die Hauptstädter zum Urlauben, der Strand ist weiß, das Meer sauber, das Essen deftig. Hier an der Küste, wo das Einkommen hoch ist, wo Schwarze und Latinos wohnen, wählen sie demokratisch; im Landesinneren, wo es immer weißer wird und die gläubigen Farmer daheim sind, Trump. So weit die Binsenweisheit.
Doch so einfach ist es nicht, sagt Kelli. Vor allem nicht bei dieser Wahl, bei der wichtigsten seit Langem, wenn nicht seit immer. Die Tourismusmanagerin, Ende 50, blondes Jahr, das Lachen so laut und amerikanisch wie nur was, wäre die perfekte Trumpistin. Sie schimpft laut darüber, dass „sechs von zehn Leuten bei unseren Jobinterviews einfach nicht mehr auftauchen“, dass die Jungen alle glauben, „der Staat oder die Eltern würden es schon richten“. Ist stolz auf ihre Tochter, die Journalistin werden will und dafür drei Sommerjobs gleichzeitig macht („vielleicht wird sie ja Millionärin“), und träumt davon, in der Pension nach Florida zu ziehen, weil dort „immer Sommer ist“.

Die Lebensmittelpreise in den USA sind massiv gestiegen
Aber Kelli sitzt auch im Graben, und zwar nicht an der Seite Trumps. „Ich weiß, dass er verrückt ist“, sagt sie. Die Dinge, die er über Frauen sagt, puh, und ja, Moral, davon habe er nicht viel. Wählen wird Kelli ihn trotzdem, denn „er ist das kleinere von beiden Übeln“, sagt sie. Er wisse wenigstens, wie man die Wirtschaft ankurble, Harris hingegen würde nur das Füllhorn ausschütten, „die Leute dürfen nicht alles gratis bekommen“. Wir stehen bei Starbucks, der große Caffè Latte kostet acht Dollar. „Alles ist doppelt so teuer wie noch vor ein paar Jahren“, sagt Kelli. Sie kauft heute nichts.

Obdachlose unweit vom Weißen Haus: Reichtum und Armut liegen in Washington nahe beinander
Warum Harris?
Die Vereinigten Staaten 2024, das sind von außen nur mehr Gegensätze. Die Milliardäre haben ihren Reichtum in den letzten sieben Jahren verdoppelt, zeitgleich gelten 18 Prozent der Menschen als arm, von allen OECD-Ländern sind es nur in Costa Rica mehr. Zwischen schrecklich arm und schrecklich reich braucht es selbst in Washington nur wenige Schritte: Ein paar Blocks neben dem Weißen Haus hausen Menschen in Zelten. Nicht nur Hilfsbedürftige, auch Menschen mit normalen Jobs hängen dort fest. Sie bekommen einfach keine Wohnung mehr bei diesen Preisen.
Jake, 31, dunkler Bart und Halbglatze, hat hier ganz in der Nähe gelebt. Er war auch nur ein paar Straßen entfernt, als der Mob am 6. Jänner 2021 Richtung Kapitol rannte, nachdem Donald Trump ihn aufgepeitscht hatte. Tagelang stand damals das Militär vor seinem Haus, „das war richtig surreal“, sagt der Historiker heute. „Ich hatte das Gefühl, als sei ich im Bürgerkrieg gelandet.“
Jake ist Demokrat, und auch hier landet man wieder beim Wort typisch. Vor einiger Zeit ist er ist weg aus Washington, nach Frederick, Maryland, eine Stadt voller hipper Cafés und roter Backsteinhäuser, die auch in Europa Platz hätte. „Hier braucht man kein Auto“, sagt er und lacht, „das ist fast unamerikanisch.“ Republikaner muss man hier suchen, Trump-Schilder in den Vorgärten gibt es so gut wie keine.
Aber auch bei Jake ist es wie bei Kelli. Er kennt sein Land viel zu gut, um zu sagen: Hey, mit Harris wird alles super. Seine Vorfahren, ausgewandert aus Deutschland, kämpften im Unabhängigkeitskrieg, und er selbst erzählt als Stadthistoriker in Frederick genau diese Geschichte: Die Vereinigten Staaten, das ist dieser Bund, der immer dem Motto der „More perfect Union“ folgt, das die Gründungsväter ihm in die Verfassung schrieben. Jenes Land, das immer an sich arbeitet, um besser und besser zu werden, und das für alle, die mitmachen, ein einziges, großes Zukunftsversprechen ist. Von dem, wenn man ehrlich ist, aber nicht mehr allzu viel übrig ist.
„Doom and gloom“ nennt Jake das, was sich über den so uramerikanischen Optimismus gelegt hat. Pessimismus, Trübsinn, Düsternis; die Tatsache eben, dass Republikaner und Demokraten einander einfach gar nichts mehr zu sagen hätten. Ob er Trump-Fans im Bekanntenkreis hat? „Nein“, sagt Jake, nicht mal moderate Republikaner, und auch in seiner eigenen Familie gebe es ordentliche Risse. Hinter ihm im Barbecue-Lokal hängen mehrere TV-Bildschirme, bei MSNBC läuft gerade die Schlagzeile „Trump soll Hitler bewundert haben“. Auf Fox wettert ein Moderator parallel über Kamala Harris’ verfehlte Migrationspolitik.
Kein Versöhner in Sicht
Ist Trump an all dem schuld? Am Schreien, am Verhöhnen?
Jake überlegt kurz und sagt „nein“. Das habe schon früher begonnen, Trump sei nur der jüngste Höhepunkt. Da war Newt Gingrich, jener Republikaner, der in den 1990ern die altgediente Kompromisspolitik zwischen den Parteien abschaffte. Da war die Tea Party, die die Radikalen bei den Republikanern immer weiter in die Mitte schob. Und da war Barack Obama, der vom liberalen Amerika 2008 als Durchbruch schlechthin gefeiert wurde – aber für viele Konservative ein derartiger Gottseibeiuns war, dass sie einen Un-Politiker wie Trump förderten.
Politologen sprechen da vom Pendel, das immer weiter ausschlägt, immer weiter in die Extreme; ausgerechnet in Amerika, der selbst ernannten Wiege der Demokratie. Was das für die Zukunft heißt?
Kelli und Jake sind politisch meilenweit voneinander entfernt, ihre Ängste sind aber die gleichen. „Der amerikanische Traum ist zerbrochen“, sagt Kelli, viel Hoffnung schwingt da nicht mehr mit. „Es gibt einfach keine Einheit mehr, aber genau die bräuchten wir.“ Jake sagt leise: „Nach der Wahl wird nichts besser werden – egal wie es ausgeht.“ Man merkt ihm das Unwohlsein körperlich an.
Einen, der den Graben zuschüttet, würden sich beide wünschen. Eine Versöhnerfigur, kein Feindbild, ganz egal von welcher Partei.
Nur ist die nicht in Sicht.
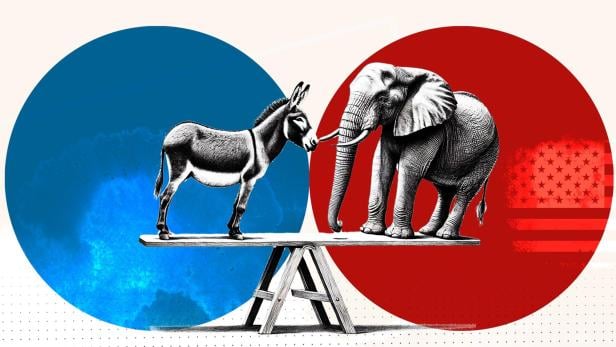


Kommentare