Die Angst vor dem Weltuntergang ist auch nicht ganz neu

Die Angst vor Atombomben begleitete die späten 1970er Jahre
Kurier: Krieg, Pandemie und Klimakrise – eine gewisse Endzeitstimmung macht sich breit, das bestätigen auch Umfragen. Nun gab es auch in den späten 1970er Jahren Ereignisse, die man durchaus als Zeitenwende bezeichnen kann, von Atomängsten, der islamischen Revolution bis zu Margaret Thatchers Wahl. Sie haben über diese Welt im Wandel geschrieben. Ist das, was wir nun erleben, in irgendeiner Weise vergleichbar?
Frank Bösch: Ob etwas singulär ist, hängt immer von der Perspektive des Betrachters ab und die wandelt sich. Ob etwas in einer Gesellschaft als wichtig wahrgenommen wird, verändert sich. Wenn etwa Zeitgenossen in fünfzig Jahren zurückblicken, hängt es von ihren dann aktuellen Erfahrungen ab, ob etwas eine Zeitenwende war oder nicht. Ich glaube, dass aus der Zukunft betrachtet die Covid-Krise eine Zäsur bleiben wird. Und zwar nicht aufgrund der Zahl der Toten, sondern auf Grund der Vielfalt der gesellschaftlichen Einschränkungen. Aber die Aufmerksamkeit darüber wird überlagert werden. Der russische Einmarsch in der Ukraine zeigt jetzt, wie schnell sie sich wandeln kann. Ähnliches sahen wir bei der sogenannten Migrationskrise. In dem Moment, als Covid aufkam, da war das Thema Flüchtlinge plötzlich verschwunden.
Das heißt, ob etwas als historisch einschneidend ist, hat auch mit unserer Wahrnehmung zu tun.
Ja, es ist immer kommunikativ hergestellt. Es gibt kein historisches Ereignis, das als solches eine Zäsur oder eine Zeitenwende ist, sondern die öffentliche Wahrnehmung formt diese. Dass ausgerechnet dieser Krieg jetzt als Einschnitt gilt, liegt daran, dass wir uns der nahe Ukraine besonders verbunden fühlen. Aus dieser Wahrnehmung heraus bekommt sie besondere Aufmerksamkeit. Die aktuelle Krise reaktualisiert Ängste, die nach 1979 ähnlich auftraten. Die Endzeitängste im Zuge der atomaren Nachrüstung und des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan waren vermutlich sogar noch stärker als die Kriegsängste heute. Auch damals gab es Millionen Flüchtlinge, die aus Afghanistan flohen. Im Unterschied zu den ukrainischen Flüchtlingen erreichten die Afghanen jedoch damals selten Europa, weil verschärfte Visavorschriften gegen sie verhängt wurden.

Historiker Bösch: "Es gibt kein historisches Ereignis, das als solches eine Zäsur oder eine Zeitenwende ist, sondern die öffentliche Wahrnehmung formt diese."
Wenn wir sagen, das hat mit Wahrnehmung zu tun, kann man auch davon ausgehen, dass die heutigen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation hier eine Rolle spielen?
In den letzten zwanzig Jahren hat es viele Kriege in der Welt gegeben. Aber wir nehmen nur bestimmte wahr, während Konflikte wie in Äthiopien, im Sudan oder im Jemen eine geringere Aufmerksamkeit bekommen. Wir hierarchisieren in unserer Wahrnehmung, obwohl, oder gerade weil die neuen Medien die Möglichkeit geben, jeden Krieg zu beobachten. Russland war schon zuvor im Fokus unserer Medienwelt und dadurch wird dieser Konflikt stärker wahrgenommen als andere, wie etwa in Afrika oder Südasien.
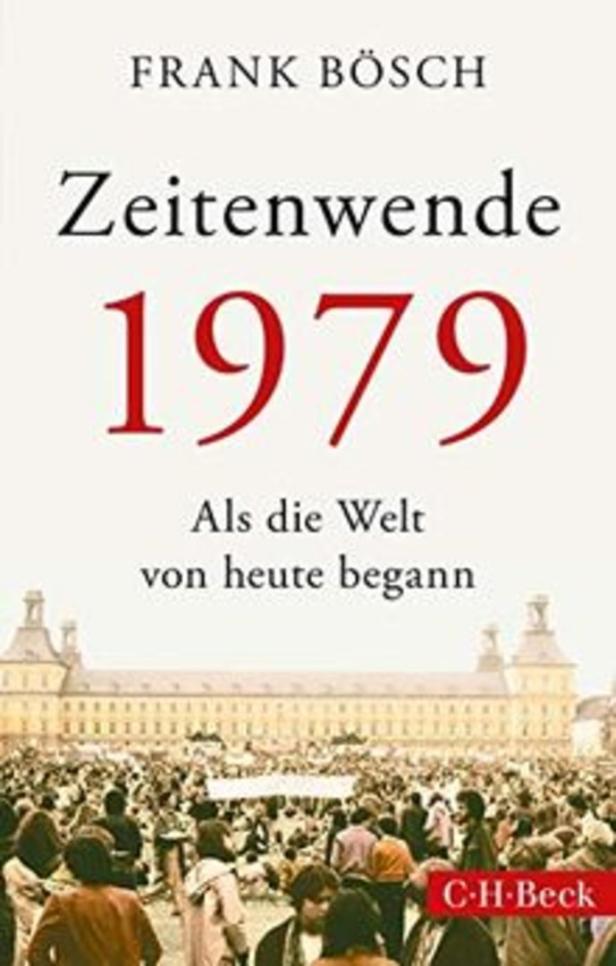
Frank Bösch: Zeitenwende 1979 – Als die Welt von heute begann
Verlag C.H. Beck 512 Seiten 28 Euro
Nun hat das ja nicht nur mit der räumlichen Nähe zu tun, sondern auch damit, dass uns die Konsequenzen dieses Konflikts viel direkter treffen, nicht zuletzt die Energiekrise.
Auch hier bestehen Bezüge zu den 1970er Jahren. Auch damals kam es zu Energiekrisen in Folge des Krieges im Nahen Osten. Es gab große Ängste, dass die Energieversorgung nicht sichergestellt ist, und auch entsprechende Reaktionen, diese neu zu sichern, etwa mit Gas aus Russland. Wir haben seit den 1970er Jahren eine viel stärker verflochtene Welt, eine verstärkte Globalisierung. Die Verflechtung mit arabischen Staaten, zu denen wir jetzt wieder neue Bande knüpfen, war damals sogar enger.
Kann man daraus schließen, dass Sie in den damaligen globalen Wendepunkten gewissermaßen den Beginn unserer Gegenwart verorten? Wurzeln aktuelle Herausforderungen in Globalisierung und Ökologie in der Zeitenwende der späten 1970er?
Vieles, das wir heute sehen, hat sich dort etabliert. Etwa die systematische Aufnahmen von Flüchtlingen von außerhalb Europas, damals mit den Boat-People, die Formierung von Umweltbewegungen, die Auseinandersetzung um Energiefragen. Wir haben Kontinuitätslinien und ähnliche Konstellationen. Die aktuelle Bedrohung durch Russland unterscheidet sich vom Kalten Krieg. Aber zugleich wird deutlich, dass 1989 nicht die Zäsur war, die alles verändert hat. Damals war ja die Annahme, dass das der bipolare Ost-West-Konflikt mit der Sowjetunion sein Ende gefunden hat. Dies trat nicht ein. Die klassische Angst vor Russland, die im 20. Jahrhundert ja sehr prägend war, wird wieder reaktiviert.
Wir haben auf viele Herausforderungen von damals geantwortet und manche auch gemeistert. Gerade im Umweltbereich. Ich denke da etwa an das Ozonloch. Sehen Sie jetzt die Chance, dass manches wieder auf einen vernünftigen Weg gebracht werden könnte?
Eine Krise markiert nicht unbedingt einen Niedergang. Eine Krise ist ein Moment, der eine grundlegende Entscheidung zur Problembewältigung verlangt. Es muss einen Kurswechsel geben, um Unheil abzuwenden. Insofern kann eine Krise dazu führen, dass etwas Neues entsteht. Die Konsequenz der Ölkrisen der 1970er war, dass man verstärkt auf Gas und Atomenergie setzte und Energie einsparte. Jetzt kann es zu neuen Weichenstellungen kommen. Neben mehr erneuerbarer Energie wohl mehr Öl und Flüssiggas aus dem mittleren und Nahen Osten. Auch der sowjetische Afghanistan-Einmarsch eröffnete Parallelen für die Zukunft. Dort führten fortgesetzte Verhandlungen und ein Politikwechsel unter Gorbatschow aus dieser verfahrenen Krisensituation heraus. Die Krise der Sowjetunion hatte hier unintendierte positive Konsequenzen. Und so pessimistisch ist selbst jetzt gerade bin, muss man daran arbeiten, wie damals neue Wege zu eröffnen. Aber eben oft unter furchtbaren Opfern.
Sie sagen, Sie sind pessimistisch?
Ein gesichtswahrender Rückzug für Putin wird schwierig. Als Historiker weiß ich aber natürlich, dass am Ende nichts für die Ewigkeit ist und dass sich vieles viel schneller wandelt, als man denkt. Aber niemand weiß nicht, in welche Richtung. Ich habe viele Interviews zu Krisen geführt. Zur Finanzkrise, zur Covid-Krise, zur Migrationskrise. Immer hieß es: das Thema bleibt auf ewig. Aber ehrlich, wann haben Sie das letzte Mal etwas zur Finanzkrise geschrieben? Und selbst in Österreich ist das sehr intensiv behandelte Thema Migration nun in den Hintergrund gerückt.






Kommentare