Sammeln von Gesundheitsdaten: Die Gefahren und Chancen

Der gläserne Patient ist keine düstere Zukunftsvision mehr, sondern spätestens jetzt Realität. Denn diese Woche gab das US-Versicherungsunternehmen John Hancock bekannt, dass man bei Lebensversicherungen nur noch „interaktive" Varianten anbieten werde – also solche, bei denen die Versicherten ihre Fitness- und Gesundheitsdaten über Smartphones, Fitnessband oder eine Smartwatch tracken. Damit sammeln die Kunden Punkte, für die sie im Gegenzug ermäßigte Versicherungsprämien zahlen oder in diversen Geschäften und Hotels Rabatte bekommen.
Optional hat die Versicherung diesen Dienst schon seit 2015 angeboten. Betont wird dabei, dass die Methode zu einem deutlich gesünderen Lebensstil beiträgt. So gehen die Versicherten angeblich doppelt so viele Schritte wie ein Durchschnittsamerikaner. Zugleich melden sich aber Datenschützer zu Wort, welche die dystopische Vision Realität werden sehen, bei der mit Überwachungstechnologien jene Menschen diskriminiert werden, die sich nicht zu einer medizinischen Optimierung ihres Lebensstils überreden lassen wollen. Marianne Harrison, CEO von John Hancock, widerspricht diesen Bedenken: Erstens habe man ohnehin schon Erfahrung mit relevanten Finanz- und Gesundheitsdaten und lege daher viel Wert auf Datenschutz. Zweitens entscheide der Kunde selbst, welche Daten er mit der Versicherung teilt.
Schleichender Prozess
Dass die Entwicklung dennoch bedenklich ist, skizzierte zuletzt der Soziologe Stefan Selke im Gespräch mit dem KURIER. Derzeit würden Menschen zwar noch belohnt, wenn sie ihre Gesundheitsdaten aufzeichnen. „Aber wenn sich diese Systeme verbreiten, werden wir auch die Schattenseiten kennenlernen, nämlich, dass Leute bestraft werden, die solche Systeme nicht nutzen“, sagt Selke.
Diesen Wandel spüre man nicht sofort, sondern er finde schleichend statt: „Wenn er sich verbreitet, wird es von einer Generation auf die andere einen spürbaren Effekt haben“, sagt Selke. „Das ist ein Prozess, der zehn oder zwanzig Jahre braucht.“ In Zukunft werde es normal sein, Transparenz in allen Lebensbereichen zu erzeugen.
Zurückhaltung in Österreich
Nicht sonderlich spürbar ist dieser Wandel bei den heimischen Versicherungen. So heißt es etwa von der Wiener Städtischen, dass man keine Versicherungen in Kombination mit Tracking anbiete und dies auch in naher Zukunft nicht plane. Ähnlich ist die Situation bei der Merkur-Versicherung: „Ich sehe die Verwendung von Fitness- und Gesundheitsdaten sehr kritisch“, sagt Gerald Kogler, Generaldirektor der Merkur-Versicherung, und verweist auf datenschutzrechtliche Gründe. Er zweifelt auch Relevanz und Überprüfbarkeit der Tracking-Ergebnisse an: „Wie kontrolliere ich, dass wirklich Sie die angegebene Schrittzahl absolviert haben? Ich halte das eher für einen Werbegag, bei uns ist nichts dergleichen geplant.“
Andere private und gesetzliche Versicherungen setzen zwar nicht auf Tracking über spezifische Geräte, koppeln die Motivation der Versicherten zu einem gesunden Lebensstil aber an finanzielle Anreize. Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) bietet in ihrem Programm „Selbstständig Gesund“ einen halbierten Selbstbehalt an (10 statt 20 Prozent), wenn mit dem Arzt vereinbarte Gesundheitsziele – in den Bereichen Blutdruck, Gewicht, Bewegung, Tabak und Alkohol – erreicht werden. „Die Überprüfung erfolgt aber nur im Zuge eines ärztlichen Gesprächs, einer klinischen Untersuchung und eines Fragebogens“, sagt Karin Nakhai von der SVA. Und wenn man in einer „Bewegungsbox“ Versicherten auch Schrittzähler übergebe, dann nur zur persönlichen Motivation“. Geplant sei aber, Wearables für die Tele-Rehabilitation auf freiwilliger Basis einzusetzen – wenn Patienten nach einem stationären Aufenthalt ambulant weitertrainieren. „Wir überlegen Einsatzmöglichkeiten von Wearables auch für Präventionsmaßnahmen – ebenfalls auf freiwilliger Basis“, heißt es von der SVA.
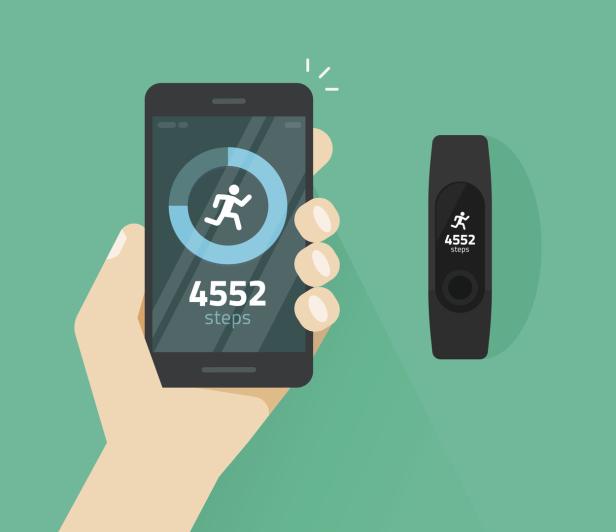
Bei der Uniqa wiederum können sich die Versicherten im Rahmen des „FitnessBonus“ bis zu 200 Euro Krankenversicherungsprämie pro Jahr sparen, indem sie sich von einem externen Sport- oder Allgemeinmediziner bescheinigen lassen, dass sie gewisse Kriterien, etwa zu Wirbelsäule, Beweglichkeit und Körperfett, erfüllen. Die Versicherung betont, dass sie keinen Zugriff auf die detaillierten Daten der Versicherten hat, sondern vom Arzt nur eine Kennzahl bekommt, die sich aus den einzelnen Faktoren zusammensetzt. Zugleich heißt es, dass man in naher Zukunft neue Angebote dieser Art präsentieren werde. Ob diese auch mit Trackern und dem Sammeln von Daten zu tun haben, darüber gibt man sich bei der Uniqa noch verschlossen.
Einen Schritt weiter ist hier jedenfalls die AOK in Deutschland. Mit der „AOK Bonus-App“ werden Daten an die Versicherung übermittelt und der Versicherte erhält dadurch Vorteile, wie Gutschriften auf Zahlungen. Auch die zurückgelegten Schritte, die per App getrackt werden, fließen in die Bewertung ein. Die AOK betont dabei aber, dass keine Fitness- oder Vitaldaten direkt an sie übertragen werden.
Positiver Nutzen bei Diabetes
Dass die Patienten selbst von den neuen Technologien profitieren können, zeigt unter anderem das Beispiel von Peter P. Hopfinger von „Diabetes Austria - Initiative Soforthilfe für Menschen mit Diabetes“. Er misst seinen Glucosewert mit einem Sensor, der am Oberarm platziert wird. Hält er ein Lesegerät oder sein Smartphone an den Sensor, wird der aktuelle Wert angezeigt.

Peter P. Hopfinger zeigt, wie das unblutige Glucose-Messen funktioniert.
„Ich messe jetzt 15 bis 19 Mal am Tag, früher habe ich mich für die Blutmessung maximal sechs Mal am Tag gestochen.“ Die häufigeren Messungen helfen ihm und den Ärzten, die benötigten Insulinmengen über den Tagesverlauf besser abzustimmen. „Das ist die Zukunft.“



Kommentare