Zwei Monate Covid-19: Die Erfahrungen der Intensivmediziner

Intensivstation: Die Liegedauer der Patienten beträgt im Schnitt zwei bis vier Wochen.
Die Erfahrungen aus knapp zwei Monaten intensivmedizinischer Betreuung von Covid-19-Patienten haben jetzt Experten der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) zusammengefasst und in einer Aussendung veröffentlicht.
Bei allen regionalen Besonderheiten gebe es doch einige gemeinsame Tendenzen, sagt Klaus Markstaller vom AKH / MedUni Wien, derzeit Präsident der Fachgesellschaft. Den rückläufigen Trend bei der Zahl der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen sehe man mit "großer Erleichterung".
Die erste Phase der Pandemie habe gezeigt, dass insgesamt nur wenige SARS-CoV-2-positive Menschen schwer erkranken. "Aber jene, die von einer kritischen Erkrankung betroffen sind, haben sehr schwere Verläufe", schreibt Markstaller. Dies sei die Erfahrung von Intensivstationen in ganz Österreich.
Allgemein beobachtet wird neben der besonderen Schwere der kritischen Erkrankung auch die ungewöhnlich lange Dauer der Intensivaufenthalte – das hatte sich bereits zu einem frühen Zeitpunkt gezeigt und wird durch weitere Erfahrungen zunehmend bestätigt.
"Auch wenn es Unterschiede nach Zentren und Regionen gibt, sprechen wir hier von Aufenthalten von zwei bis vier Wochen, das ist deutlich länger als die sonstige durchschnittliche Liegedauer auf Intensivstationen“, schreibt Markstaller.
Von schweren Krankheitsverläufen betroffen sind auch keineswegs nur hochbetage Patientinnen und Patienten: "An unserem Zentrum haben wir bisher etwa ein Durchschnittsalter von knapp 64 Jahren gesehen“, berichtet Intensivmediziner Christoph Hörmann (Universitätsklinikum St. Pölten).
Bei den Vorerkrankungen haben sich in der neuen Zusammenschau bisherige Beobachtungen bestätigt, erläutert Rudolf Likar (Klinikum Klagenfurt am Wörthersee): Bluthochdruck, die chronische Lungenkrankheit COPD und andere chronische Lungenerkrankungen, Adipositas (massives Übergewicht), Diabetes mellitus, Niereninsuffizienz, aber auch Schlafapnoe.
Verdeutlich hat sich der Befund zu den Geschlechterunterschieden: Während bei den bestätigten Covid-19-Diagnosen insgesamt nur knapp mehr Männer als Frauen betroffen sind, sieht es auf den Intensivstationen anders aus: Etwa dreimal mehr an Covid-19 erkrankte Männer wurden hier behandelt.
"Warum das so ist, ist noch wie viele andere Aspekte der Erkrankung nach dieser kurzen Zeit nicht ausreichend erforscht", sagt Intensivmediziner Walter Hasibeder (Krankenhaus St. Vinzenz, Zams). "Eine These betrifft den ACE-2-Rezeptor, der für das Andocken des Virus am Atemweg verantwortlich ist. Dieser ist bei Männern in höherer Dichte vorhanden."
Weil schwere Atemstörungen bei allen intensivpflichtigen Covid-19-Patientinnen und -Patienten im Vordergrund stehen, ist auch die Beatmung ein wichtiger Therapiebestandteil.
Hörmann: "Laut unseren Auswertungen wird etwa ein Fünftel der Patienten nichtinvasiv beatmet, die überwiegende Mehrheit wird intubiert. Likar: "Die Beatmungsinterventionen sind sehr aufwendig, hier sind auch kinetische Lagerungen, also das Verbringen in Bauchlage, erforderlich, was den Effekt der Beatmungstherapie oft deutlich verbessert."
Inzwischen kam an einigen Zentren bei einem kleinen Teil der Covid-19 Patientinnen und -Patienten mit schwerem Lungenversagen auch die Methode der extrakorporalen Membranoxygenierung (ECMO) zum Einsatz – eine intensivmedizinischeTechnik, bei der eine Maschine teilweise oder vollständig die Atemfunktion übernimmt. "Wir konnten bereits die ersten ECMO-Patienten wieder entlassen", berichtet Hörmann.
Besondere Bedeutung hat bei den schwer erkrankten Patienten die Therapie von Gerinnungsstörungen: Denn diese kommen häufig vor. Hasibeder. "Mit zunehmender Erfahrung sehen wir, dass Mikro-Gefäßverschlüsse ein Teil der massiven Probleme sein dürften."
Zum Einsatz kommt auch eine Vielfalt anderer Therapien, unter anderem etwa monokonale Antikörper und vereinzelt Therapien auf der Basis von Rekonvaleszenten-Plasma – letzteres mit unterschiedlichem Erfolg.
Die Fachgesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) spricht in ihrer Aussendung auch "unsachliche Kommentare" zur Intensivmedizin in der Öffentlichkeit an. Dies sei bedauerlich und wenig hilfreich. "Es gilt jetzt mehr denn je, Mythen durch Tatsachen zu ersetzen."
Nachstehend einige Behauptungen und der Standpunkt der Fachgesellschaft ÖGARI.
- Behauptung: Es war überzogen, Intensivkapazitäten auszubauen und freizumachen, zum Beispiel durch Verschiebung elektiver Operationen. Die Intensivstationen waren auch am Höhepunkt der Erkrankungswelle weitgehend leer.
ÖGARI: Es war richtig und wichtig, sagen die ÖGARI-Experten, dass sich die Krankenhäuser – und insbesondere die Intensivstationen – rechtzeitig sehr umsichtig und professionell auf die Corona-Krise und auf erwartbare zusätzliche Patientenströme vorbereitet haben.
Wer die Zahl der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten mit der Gesamtzahl der Intensivbetten in Relation setzt, übersieht, dass auch in Pandemie-Zeiten ein Gutteil der Intensivbetten mit Intensivpatientinnen und -patienten anderer Genese belegt sind.
Prof. Markstaller. "Wie wichtig die vorbereitenden Maßnahmen waren, zeigt schon die Tatsache, dass während der vergangenen Wochen die Belegung der Intensivbetten insgesamt, unabhängig von der Indikation, in verschiedenen Zentren, wie dem AKH Wien, bei 80 Prozent lag. In hochbetroffenen Regionen wie Teilen Tirols waren zu Spitzenzeiten alle Intensivbetten belegt."
- Behauptung: Es muss nur ein sehr kleiner Anteil der Erkrankten stationär betreut werden, die Konzentration auf den Spitals- und Intensivbereich ist übertrieben.
ÖGARI: Hier ist immer darauf zu achten, nicht aufsummierte Zahlen (etwa die insgesamt mehr als 15.600 SARS-CoV-2 positiv getesteten Menschen) mit täglichen Momentaufnahmen zu vergleichen – wie der täglich kommunizierten Zahl stationärer Covid-19 Patientinnen und -Patienten.
Der Anteil hospitalisierter Menschen an aktiv Erkrankten ist jedenfalls erheblich. Prof. Markstaller: "Tatsache ist, dass zum Glück insgesamt nicht viele SARS-CoV-2-positive Menschen ernsthaft erkranken. Die, die das aber tun, sind sehr schwer krank, wie unsere Erfahrungen auf den Intensivstationen zeigen. Schwere Verläufe von Covid-19 sind nicht mit anderen Erkrankungen vergleichbar, die wir sonst an Intensivstationen behandeln, und benötigen besonders viele Ressourcen."
- Behauptung: Auf den Intensivstationen wird übertherapiert, hier werden mit großem gerätemedizinischen Aufwand Covid-19 Patienten behandelt, für die das nicht mehr sinnvoll ist.
ÖGARI: Wir konnten in jeder Phase der Corona-Krise auch bei Covid-19-Patientinnen und -Patienten jene personenbezogene, individualisierte Intensivmedizin betreiben, wie sie auch sonst unser Prinzip ist: Das bedeutet, dass in jedem einzelnen Fall beraten wird, ob bzw. welche therapeutischen Interventionen in der individuellen Konstellation und unter Berücksichtigung der Patientenwünsche sinnvoll sind.
Prof. Likar: "Das kann auch einmal eine Einstellung der Therapie bedeuten, zum Beispiel wenn ein Patient eine Intubation ablehnt. Es ist sehr positiv, dass wir in Österreich nicht wie in anderen Ländern Triage-Entscheidungen wegen einer Knappheit an Betten treffen mussten, sondern bisher immer Intensivmedizin nach aktuellem wissenschaftlichem Standard betreiben konnten."
- Behauptung: Mit der Intubation und mechanischen Beatmung werden Schäden verursacht, diese Behandlungsform wird zu oft angewendet.
ÖGARI: Eine nicht-invasive Beatmung oder invasive Beatmung sind keine alternativen Konzepte, sondern ergänzen einander – je nach individueller Situation der Patientinnen und Patienten wird die jeweilige Vorgansweise entschieden.
Es gibt keinerlei Daten, die die Behauptung stützen könnten, es würde an Intensiv-Abteilungen zu viel oder zu früh intubiert. Natürlich ist es hier, wie bei jeder therapeutischen Intervention, entscheidend, dass qualitätsvoll und entsprechend den Leitlinien vorgegangen wird.
- Behauptung: Die Sterblichkeit von Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen ist enorm hoch, daher muss man diesen intensivmedizinischen Aufwand in Frage stellen.
ÖGARI: Es gibt keine Anhaltspunkte, dass dies in Österreich so wäre. Bisher publizierte Daten zur Intensiv-Mortalität sind nach Ländern und Regionen extrem unterschiedlich.
So weist eine Arbeit aus New York eine Sterblichkeit von 88 Prozent aus, andere Städte in den USA berichten eine 50prozentige Mortalität. Da lässt sich aber nicht einfach umlegen. Die Daten aus Österreich sehen anders aus, auch wenn es hierzulande eine gewisse Schwankungsbreite gibt: Abteilungen berichteten etwa Mortalitätsdaten von 20 bis 40 Prozent.
Mit zunehmender Zahl von als geheilt entlassenen Covid-19-Intensivpatienten zeigt sich auch, dass aufgrund der langen intensivmedizinischen Behandlungs- und Beatmungsdauer ein hoher Rehabilitationsbedarf besteht.
"Je länger die Beatmung andauert, desto mehr Atmungsmuskelmasse, aber natürlich auch Skelettmuskulatur, verschwindet. Betroffene bauen Muskelproteine ab und brauchen nach überstandener Krankheit sehr intensive physiotherapeutische Programme, um wieder auf die Beine zu kommen", erläutert Hasibeder.
"Gefahr noch nicht gebannt"
Die Intensivmediziner stehen jetzt vor einer doppelten Herausforderung, sagt Markstaller. Einerseits müssten die Versorgungsaufgaben für möglichst viele Menschen mit vielfältigen Erkrankungen, "die wir ja auch während der Krise betreut haben", weiter intensiviert werden.
"Andererseits müssen wir weiter gerüstet bleiben für einen möglicherweise wieder steigenden intensivmedizinischen Bedarf einer oder mehrerer weiterer Covid-19-Erkrankungswellen. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass die Gefahr bereits gebannt wäre."
Aus anästhesiologisch-intensivmedizinischer Sicht waren und bleiben die Maßnahmen im Rahmen des Pandemie-Managements und die engagierte Umsetzung der Vorsichtsmaßnahmen durch die Bevölkerung wesentlich, so der ÖGARI-Präsident: "Das ist die Basis für den bislang positiven Verlauf und die Tatsache, dass bisher zu keinem Zeitpunkt die intensivmedizinischen Kapazitäten bis zur Überforderung ausgereizt waren. Die vielzitierte schrittweise Rückkehr zur Normalität ist zu begrüßen, doch wichtige Vorsichtsmaßnahmen wie Händehygiene und physischer Abstand werden und sollten uns noch lange begleiten, damit diese Befunde so bleiben."
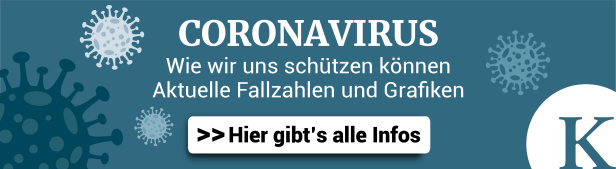


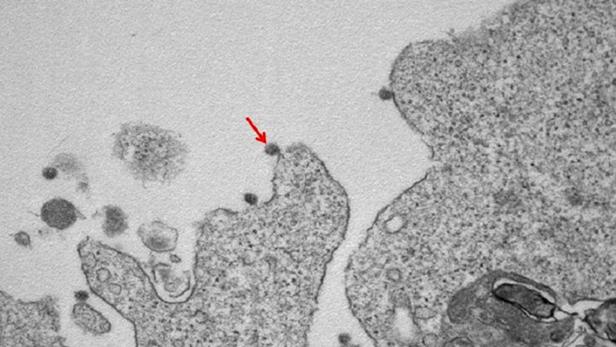
Kommentare