Krebs und andere Krankheiten: Wie die KI künftig die beste Therapie finden soll

Ein runder Schatten im Lungengewebe, kaum größer als eine Fingerkuppe: Sogenannte Lungenrundherde sind oft gutartig. Manchmal können sie auch ein frühes Krebsanzeichen sein. „Solche Lungenrundherde zu detektieren, mit dem Ziel, weniger zu übersehen und besser beurteilen zu können, ob daraus Krebs werden könnte, ist in der Radiologie inzwischen eine Aufgabe, die durch KI unterstützt wird“, weiß Georg Langs.
Der Mathematiker forscht an der MedUni Wien – aber auch am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) – dazu, wie maschinelles Lernen die medizinische Bildgebung revolutionieren kann.
Auch beim Einordnen diffuser Lungenerkrankungen unterstützt die Künstliche Intelligenz (KI) Radiologinnen und Radiologen bereits, ebenso wie bei der Früherkennung von Brustkrebstumoren. „In diesen Fällen erkennt ein Algorithmus komplexe diagnostische Informationen in radiologischen Bilddaten, da sind in Österreich schon einige Medizinprodukte im Einsatz“, präzisiert Langs. Auch für den KI-gestützten Blick ins Gehirn – etwa, um Alzheimer oder Multiple Sklerose frühestmöglich diagnostizieren oder den Verlauf beurteilen zu können – wollen viele Firmen künftig Lösungen anbieten. Oft gehen diese als Start-ups aus Universitäten hervor und setzen das dort generierte Wissen in fertig trainierten Softwareprodukten um – die dann an Kliniken zum Einsatz kommen.
Stichwort Training: Damit künstlich intelligente Modelle präzise agieren, müssen sie mit großen Mengen an Patientendaten gefüttert werden. „Hier muss natürlich in einem datenschutzrechtlich sicheren Rahmen gearbeitet werden. Dabei hat sich in den vergangenen Jahren viel getan, sodass wir inzwischen gut aufgestellt sind.“
Entscheidungshilfen
Bildgebende Verfahren – ein Röntgenbild, eine MRT, ein Ultraschall – bilden immer einen Status quo ab. In die Zukunft kann man damit nicht schauen. Hier liegt das Potenzial der KI. „Die Forschung geht dahin, Informationen aus den Bildern stärker für prognostische Zwecke zu nutzen“, erklärt Langs. Dabei geht es nicht nur um das individuelle Erkrankungsrisiko. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Behandlung bei einem Patienten oder einer Patientin erfolgreich anschlägt, soll so errechnet werden können. „Weil die Zahl verfügbarer Therapien rasant zunimmt, wird es immer wichtiger, die richtige für den richtigen Patienten zur richtigen Zeit zu wählen.“ Solche Berechnungen könnten Patienten außerdem unnötige weitere Untersuchungen oder Eingriffe ersparen.
Immer wieder ist in diesem Kontext von digitalen Patientenzwillingen die Rede. An ihnen sollen Therapien simuliert und vorab getestet werden. Wie greifbar sind solche Lösungen aus heutiger Sicht? „Das liegt in der Routineanwendung noch in der Zukunft, ist aber schon in wissenschaftlicher Entwicklung“, sagt Langs. So werden derzeit etwa im Rahmen des EU-Projekts ARTEMIS Daten für Computermodelle, die maschinelles Lernen und Simulation vereinen, erhoben, um personalisierte Behandlungen von Fettleberpatienten zu ermöglichen.

Mathematiker Georg Langs: Vom Beobachten hin zum Erklären kommen.
Wie relevant das Thema ist, zeigt auch der diesjährige Europäischen Kongress für Radiologie, der dieser Tage in Wien stattfindet. Auch dort dreht sich heuer alles um die digitale Zukunft der Radiologie.
Vom Vorhersagen zum Verstehen
Auf Vorhersagen lässt sich die KI immer besser programmieren, sagt Langs. Die Königsklasse in der Medizin sei aber das Verstehen. „Wenn die KI 1.000 Patienten beobachtet, kann sie vielleicht zuverlässig vorhersagen, was beim 1.001. passiert. Die Herausforderung ist, von Beobachtungen zu Erklärungen zu kommen – also dahinterstehende Mechanismen aufzudecken und basierend darauf neue Therapien anzustoßen.“
Noch vor einigen Jahren wurde die Debatte, ob die KI Fachleute in der Medizin ersetzen wird, hochemotional geführt. „Das ist inzwischen eher kein Thema mehr“, weiß Langs. „Alle Anwendungen, die heute gut funktionieren, bauen auf eine Zusammenarbeit von KI und Experte – und am Ende entscheidet immer der Arzt oder die Ärztin.“ Es gehe auch nicht darum, den Status quo einzufrieren und zu automatisieren, „sondern bessere Diagnosen zu erstellen“.
Was KI jedenfalls jetzt schon kann: Zeit sparen. Etwa bei zeitaufwendigen radiologischen Verlaufskontrollen, die dazu dienen, den Krankheitsverlauf eines Patienten zu erfassen und zu dokumentieren. „Die KI kann den Vergleich von Scans deutlich beschleunigen, und ermöglicht gleichzeitig die Erkennung subtiler Veränderungen.“
Direktor Kontakt mit der KI
Patientinnen und Patienten könnten künftig auch direkt in Kontakt mit der KI kommen. Etwa über Chatbots, die vor radiologischen Untersuchungen aufklären oder auf ein ärztliches Befundgespräch vorbereiten. „Das ist alles vorstellbar, wenn Datenschutzthemen vorab geklärt werden.“
Besonders spannend ist ein Forschungsprojekt (AI-POD), an dem Langs als Teil eines internationalen Teams aktuell arbeitet. Per Computertomografie kann heute frühzeitig erkannt werden, ob ein Herzinfarktrisiko besteht. Zeitnahe Lebensstiländerungen können dieses Risiko verändern. „Wir versuchen gerade, diese Risikoberechnung mit KI zu verbessern und gleichzeitig näher an die Patienten zu bringen, indem wir sie mit digitalen Schrittzählern und einer Smartphone App ausstatten.“ Mit dem Ziel, „noch bessere Prognosen erstellen zu können und Patienten nicht nur beim Besuch in der Klinik, sondern im täglichen Leben zu zeigen, wie sie ihre Herzgesundheit selbst aktiv fördern können“.



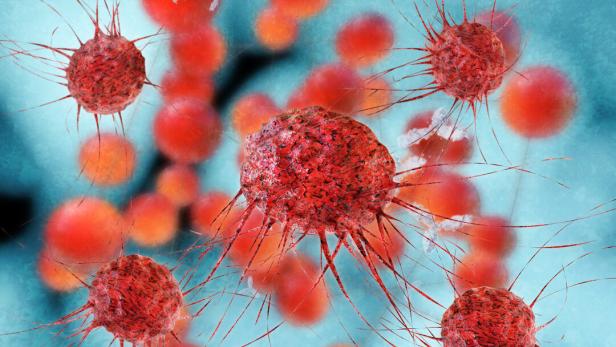
Kommentare