Medizinforschung: Wo Österreich mit der Weltspitze mithalten kann
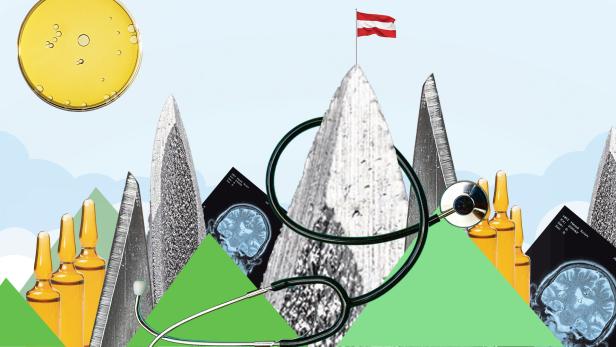
Mindestens eines von 100 Kindern ist von Autismus betroffen – Probleme in der Kommunikation sind die Folge. Bekannt ist ein Zusammenhang mit genetischen Veränderungen. Aber welche Mutation hat welche Folgen? Das untersuchen Wissenschafter des Instituts für Molekulare Biotechnologie der Akademie der Wissenschaften um Jürgen Knoblich an Hirnorganoiden. Das sind dreidimensionale Gewebestrukturen, die sie im Labor mit menschlichen Stammzellen erzeugen. An ihnen kann man die Organentwicklung studieren. Die Publikation ihrer Erkenntnisse im hochrangigen Fachmagazin Nature sorgte international für Aufsehen.
Ein Team um Ursula Schmidt-Erfurth, Leiterin der Uni-Augenklinik von MedUni / AKH Wien, entwickelte das erste automatische Diagnosetool für Netzhauterkrankungen auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI): „Das ist die erste komplett autonome KI-Zulassung, die dafür sorgt, dass Augenärzte überall in der Welt zu jeder Zeit bei jedem Patienten eine genaue Auswertung der Netzhautsituation machen können.“

Die Netzhaut besitzt auf einer Fläche von wenigen Quadratzentimetern rund 126 Millionen lichtempfindliche Sinneszellen.
In Österreich tätige Forscherinnen und Forscher zählen in einigen Bereichen der Medizin zur Weltspitze – trotz vielfach knapper finanzieller und personeller Ressourcen.
Mehr zu einigen Beispielen können Sie hier lesen:
➤ Mehr lesen: Spinnenseide zur Nervenheilung, Smartphones zur Herzdiagnostik
Einige Top-Positionen
Markus Müller, Rektor der MedUni Wien, zieht einen Vergleich mit dem Fußball: „Wir können es uns in der Wissenschaft leisten, in einigen Disziplinen ,Top-Spieler’ zu haben, aber sicher nicht an allen Positionen.“ Dazu fehlen die Infrastruktur und das Budget. „Deshalb können wir nur in Teilgebieten im wissenschaftlichen Wettbewerb ganz vorne mitlaufen – dort aber sehr gut mithalten.“
„Derzeit stehen wir an der Schwelle der Ära der molekularen Medizin“, sagt Müller. „Mein Lieblingswort ist Deep Medicine, tiefe Medizin.“ Keine oberflächliche Diagnose und Therapie – Stichwort Fünf-Minuten-Medizin –, sondern eine auch von Computern unterstützte tiefe Analyse des Gesundheitszustandes.

Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien.
Was das bedeutet? „In der Geschichte der Medizin hat man zuerst gesagt: ’Der Mensch besteht aus Organen – lernen wir etwas über die Organe, dann können wir auch Krankheiten heilen’. Dann hat man entdeckt, dass der Mensch aus Zellen besteht. Und jetzt sind wir auf der Ebene der Moleküle und Daten, der kleinsten Teilchen. “
➤ Mehr lesen: Fußball und Medizin: Welche Bedeutung Daten heute haben
Präzisionsmedizin ist das Stichwort. „Das heißt, wir suchen individuelle Stecknadeln im Heuhaufen. Mittlerweile gibt es sehr viele Beispiele von Patienten, die ohne diese Möglichkeiten der modernen Medizin nicht überlebt hätten.“ Müller erzählt von einem Betroffenen: „Wir hatten an unserer Uni einen Studenten, der an Leukämie erkrankt war und bei dem keine der etablierten Therapien wie Stammzelltransplantationen einen Erfolg zeigte.
Dann haben sich unsere Spezialisten die molekularen Grundlagen seiner Erkrankung angesehen, indem sie das Erbgut seiner Krebszellen sequenziert, also die Abfolge seiner DNA-Bausteine aufgeschlüsselt haben.“ Dabei habe man eine Mutation entdeckt, „von der man bisher gar nicht angenommen hatte, dass sie bei seiner Form der Erkrankung auftritt“.
Ein Leben gerettet
Diese Mutation bewirkte die Veränderung eines speziellen Enzyms – etwas, das man von anderen Krankheiten kannte und wogegen es auch ein Medikament gibt. „Der Patient wurde geheilt – aber ohne den tiefen Blick auf die molekulare Struktur seiner Erkrankung wäre man niemals auf die Idee gekommen, gerade dieses Medikament zu verabreichen.“
Österreich sei keine KI-Supermacht, „aber unsere Strategie ist, in Nischen vorne mit dabei zu sein“. Ein Zeichen einer gewissen Aufbruchsstimmung ist die Rückkehr von Top-Expertinnen und Experten von renommierten ausländischen Institutionen nach Österreich.
Dazu zählt der neue Chef des ISTA (Institute of Science and Technology) in Klosterneuburg, NÖ, Martin Hetzer, ebenso wie die zukünftige Rektorin der MedUni Graz, Andrea Kurz.
Ein Interview mit ihr können Sie hier lesen:
➤ Mehr lesen: "Stanford hat höheres Budget als alle österreichische Universitäten zusammen"
„Dafür brauchen wir aber auch die Infrastruktur.“ Ein Vorzeigeprojekt wird das nach Eric Kandel benannten „Zentrum für Präzisionsmedizin“ sein, das derzeit am MedUni Campus AKH gebaut wird. Und es gibt den Plan, dass mehrere Träger gemeinsam in Wien ein „Institute for Artificial Intelligence and Biomedicine“ errichten.
"Wir können nur in Teilgebieten im wissenschaftlichen Wettbewerb ganz vorne mitlaufen"
Österreich habe zwar den Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt von 1,5 Prozent Mitte der 90er-Jahre auf rund 3,2 Prozent heuer erhöht – rund 50 Prozent davon werden von Unternehmen finanziert. Aber die „bittere Pille“ sei, dass viel zu wenig Fokus auf der Grundlagenforschung liege. Erst in den vergangenen Tagen warnte der Chef des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Christof Gattringer, dass die Zusage des Finanzministeriums für bereits vereinbarte Mittel noch fehle. Müller: „Der Schweizerische Nationalfonds zur Forschungsförderung gab 2022 pro Einwohner 133 Euro aus, der FWF 31.“
➤ Mehr lesen: Genetiker Josef Penninger: Wie er das Risiko für Brustkrebs senken will
Am meisten brenne es bei der Ausstattung der Universitäten, die im internationalen Vergleich nicht gut ist, sagt Müller: „Die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich hat ein Jahresbudget von knapp zwei Milliarden Euro: „Das Budget aller 22 heimischen Universitäten liegt bei etwa viereinhalb Milliarden Euro.“ Zuletzt sind im „Times“-Uni-Ranking die Medizin-Unis Graz, Innsbruck und Wien etwas zurückgefallen. Trotzdem bleibt Müller zuversichtlich: „Wir sehen bei mehreren Forschungsgruppen erste Knospen, die sehr vielversprechend sind, dass Österreich bei den modernen Entwicklungen in der Medizin mitspielen wird können.“
Kommentare