Was die Nationalbank mit der Atomkraft am Hut hat
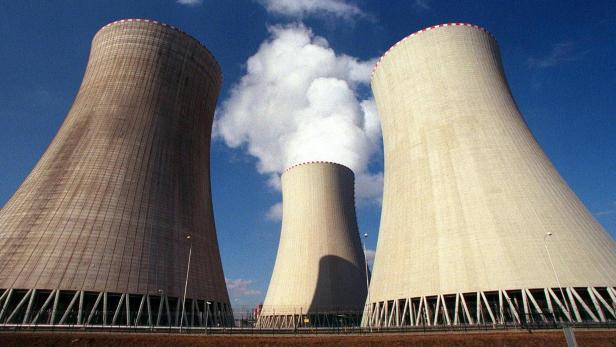
An diesem Mittwochnachmittag findet in den Räumlichkeiten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) ein eher ungewöhnlicher Termin statt. OeNB-Gouverneur Robert Holzmann lädt zu einem „hochrangigen Expertendialog zur Energiewende“ ein, es geht aber nicht um eine breite Debatte, vielmehr lässt Holzmann ein Thema erörtern, auf das bisher nur die Freiheitlichen gesetzt haben: Thorium-Reaktoren.
Dabei handelt es sich jedenfalls um Atomkraft, wenn auch nicht im herkömmlichen Sinn: Das sind Flüssigsalzreaktoren. Statt mit Uran arbeiten diese mit dem schwächer strahlenden und auf der Erde reichlich vorkommenden Element Thorium. Neben Testreaktor-Projekten in China, Indien, den USA oder der Schweiz, heißt es in der Einladung der OeNB, entwickle das Grazer Green-Tech-Start-up Emerald Horizon AG „neue Technologien für die Nutzung von Kernenergie aus Thorium, die zeitnah einsatzbereit sein sollen“.
Zuletzt hatte sich der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) für eben dieses Thema stark gemacht. Holzmann ist parteifrei, sieht sich als liberal-freiheitlich und wurde 2019 von der damaligen Regierungspartei FPÖ in das Amt befördert.
In der OeNB erklärt man das Vorgehen damit, dass die Veranstaltung Teil einer Diskussionsreihe um Europas Energiezukunft sei – und da müsse auch Platz für Atomkraft sein, so ein Sprecher von Gouverneur Holzmanns zum KURIER.
Wenig erfreut zeigen sich die Energiesprecher der Parlamentsklubs (ÖVP, FPÖ und Neos nahmen bis Redaktionsschluss keine Stellung): Alois Schroll, Energiesprecher der SPÖ, sagt zum KURIER: „Die Idee der Thorium-Reaktoren gibt es seit Jahrzehnten, kommerziell einsetzbar ist das aber bislang nicht. Möglicherweise ist man erst in 20-30 Jahren soweit, dass diese Kraftwerke funktionieren. Bis dahin müssen wir unser Energiesystem aber längst fertig umgebaut haben. Insofern sind Thorium-Reaktoren keine Lösung für unseren gegenwärtigen Energiebedarf.“
Der grüne Energiesprecher Lukas Hamer sieht zudem einen Konflikt mit der Verfassung: „Gouverneur Holzmann widmet seine Veranstaltung zum Thema Energiewende ausgerechnet einer verfassungswidrigen Technologie. Die Errichtung und der Betrieb von Spaltreaktoren zur Energiegewinnung sind in Österreich durch ein Bundesverfassungsgesetz verboten und ich sehe keinen Grund, warum wir am österreichischen Anti-Atomkraft-Kurs etwas ändern sollten.“
Stabile Produktion?
Die Befürworter versprechen sich von der Atomkraft mehrere Vorteile: CO2-arme Stromproduktion zu vergleichsweise niedrigen Kosten, eine gewisse Unabhängigkeit von Energieimporten und eine stabile, ganzjährig planbare Stromproduktion. Letzteres ist vor allem deswegen relevant, weil die "neuen Erneuerbaren" Windkraft und Photovoltaik mit dem Wetter starken Schwankungen unterworfen sind. Die Erfahrungen der letzten Jahre bestätigen die Zuverlässigkeit der Kernkraft allerdings nicht.
In Europas größtem Atomstromproduzenten Frankreich kam es 2022 durch ungeplante Wartungsarbeiten und Dürre zu Ausfällen von mehr als der Hälfte der Kraftwerke. Das Land wurde vom Stromexporteur zum -importeur, die Nachbarländer mussten die fehlende Produktion kompensieren.
In Finnland wurde 2023 mit 14 Jahren Verzögerung der Reaktorblock Olkilutoto 3 in Betrieb genommen. Gekostet hat das Kraftwerk statt drei Milliarden Euro schlussendlich elf Milliarden Euro. Bereits im November musste es zwei Mal ungeplanterweise vom Netz genommen werden, im Anschluss produzierte es nur mit einem Teil der geplanten Leistung.

Der dritte Reaktor des finnischen AKW Olkiluoto wurde im Frühling 2023 in Betrieb genommen.
Massive Verteuerungen von bisher etwa 50 Prozent gibt es auch beim Projekt Sizewell C, das in Großbritannien in Bau ist. Während der britische Premier Rishi Sunak einen Ausbau der Kernkraft-Flotte angekündigt hat, steht es um die bestehenden Kraftwerke schlecht: Von zehn Reaktoren sind zwei wegen geplanter und weitere vier wegen ungeplanter Wartungsarbeiten außer Betrieb. Weniger als die Hälfte der Kraftwerke ist also einsatzbereit.
Auch die CO2-Einsparungen sind zweifelfhaft, weil bei den Berechnungen zwar der Kraftwerksbetrieb, nicht aber der Uranabbau und die Herstellung der Brennelemente berücksichtigt werden. Die zwei größten Uran-Produzenten der Welt sind übrigens Russland und Kasachstan. Ungelöst ist zudem die Frage des radioaktiven Abfalls.
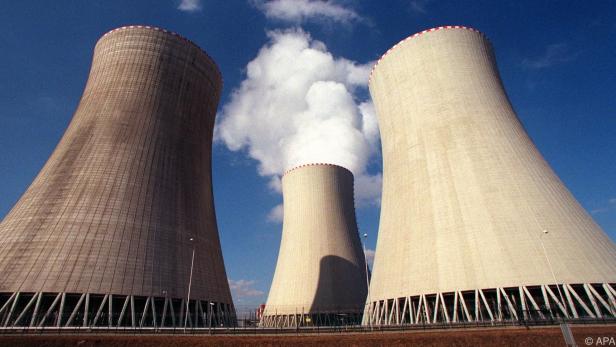

Kommentare