Drei Jahre Pandemie: "Streitigkeiten konnten nicht beigelegt werden“

Für die Studie "Corona und Familienleben" hat die Familiensoziologin Ulrike Zartler von der Universität Wien mit ihrem Team 98 Eltern mit 181 Kindern im Kindergarten- oder Schulalter befragt – über ihre Erkenntnisse spricht sie im Interview mit dem KURIER.
KURIER: Wie haben die Österreicher als Gesellschaft die Pandemie gemeistert?
Ulrike Zartler: Corona hat das Unsichtbare sichtbar gemacht, z. B. den Wert von unbezahlten Tätigkeiten wie die Betreuung von Kindern oder deren Bildung. Das ist ein riesiger Beitrag, den Familien, vor allem Frauen, unbezahlt leisten. Wir erinnern uns an den Beginn der Pandemie, wo deutlich wurde, wie wichtig der Pflegebereich oder das Personal im Supermarkt ist – Bereiche, die üblicherweise wenig Wertschätzung bekommen. Hier haben wir vielleicht etwas aus der Pandemie gelernt, wobei ich nicht von einer nachhaltigen Veränderung sprechen würde. Denn wenn der Alltag wieder einkehrt, ist manches auch wieder vergessen. Aber es war wichtig, hier diese Sichtbarkeit zu erreichen.
Muss man von einer Aufarbeitung eines gesellschaftlichen Traumas sprechen?
Ich bin keine Psychologin oder Therapeutin, daher bin ich vorsichtig mit der Verwendung des Begriffs Trauma. Es ist wichtig, die Zeit aufzuarbeiten. Und zwar auch deswegen, weil sich vieles in der Rückschau anders darstellt als zu jener Zeit, wo man etwas direkt erlebt. Manche Dinge werden einem erst bewusst, wenn man einen zeitlichen Abstand gewonnen hat. Umso wichtiger ist es, zu reflektieren: Was hat diese Pandemie mit uns als Gesellschaft gemacht?
Sie haben den Blick auf die Vergangenheit angesprochen: Im Frühjahr 2020 wussten wir wenig über das Coronavirus und wir kannten die Bilder aus Bergamo, 400 Kilometer von Österreich entfernt. Neigen wir dazu, die Vergangenheit mit dem heutigen Blickwinkel zu betrachten?
Ja. Unsere Studie, in der wir Eltern von Kindergarten- und Schulkindern seit Beginn der Pandemie wiederholt befragten, zeigt auch eine Verklärung der ersten Pandemie-Phasen: Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie, im Frühling 2022, meinten viele Befragte, dass im ersten Lockdown alles so ruhig gewesen sei und man so viel Zeit miteinander gehabt hätte - eigentlich eine schöne Zeit. In unseren wöchentlichen Gesprächen im ersten Lockdown artikulierten sie zu Beginn der Pandemie eher Angst und Unsicherheit: Man wusste wenig über Krankheitsverlauf, Ansteckung und Behandlungsmöglichkeiten. Es gab zudem nicht die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Die Situation damals ist nicht vergleichbar mit der Situation, die wir jetzt haben – das sollten wir nicht vergessen.
Welche Gefühle gab es im Zeitverlauf Ihrer Studie?
Am Anfang Angst und Unsicherheit. Mit dem Wissen, dass die Situation schon relativ lange dauert und auch nicht sehr schnell vorbei sein wird, hat sich die Erschöpfung eingestellt. In der ersten Pandemie-Phase haben viele einfach funktioniert und getan, was zu tun war. Aber bereits im Frühling 2020 haben etliche Befragte gemeint, dass sie noch einen Lockdown als Familie nicht aushalten würden. Dann machte sich eine gewisse Lethargie oder sogar Resignation breit. Diese ist einer Frustrierung und Verzweiflung gewichen. Diese Gefühle haben sicher zu dieser gesellschaftlichen Erschöpfung beigetragen: Familien haben in einem permanenten Provisorium gelebt, sie mussten sich an ständig geänderte Rahmenbedingungen anpassen. Familien haben Großes geleistet, aber das hatte seinen Preis, wie wir anhand der psychischen Probleme sehen. Positiv ist festzuhalten, dass es vielen Familien gut gelungen ist, die Pandemie in ihr Leben zu integrieren. Aber es gibt wichtige Unterschiede: Für Alleinerzieherinnen oder Familien mit geringem Einkommen war es ungleich schwieriger.
Was hätten offene Schulen gebracht?
In der Schule hat man Möglichkeit, dass pädagogisch geschulte Personen sich mit den Kindern auseinandersetzen und ihre Erfahrungen diskutieren können. Zudem macht es einen großen Unterschied, ob ich mit meinen Eltern alleine zu Hause bin oder ob ich andere Kinder rund um mich habe, die in der gleichen Situation sind. Aber in den frühen Phasen ging es ja darum, dass sich die Schulen überhaupt erst organisieren, um Homeschooling anbieten zu können.
In Ihrer Studie kam heraus, dass die Eltern sich im Stich gelassen gefühlt haben. Von wem?
Dieses Gefühl war in den ersten Pandemie-Phasen besonders stark, weil Eltern den Eindruck hatten, dass in Sachen Kinderbetreuung und Homeschooling, oft noch in Kombination mit Homeoffice, nicht gesehen wird, was sie leisten. Zu dieser mangelnden Wertschätzung kam auch die mangelnde Unterstützung: Wir erinnern uns an das politische Signal, dass es eigentlich nicht erwünscht war, Kinder in die Betreuung zu geben bzw. nur wenn Eltern völlig überfordert waren. Das ist ein Bild, das man nicht gerne von sich vermitteln will. Zu Beginn gab es auch Überlegungen, dass die Pandemie Auswirkungen auf die Geschlechterrollen haben könnte. Hier muss man klar sagen: Wir sehen auch drei Jahre nach Beginn der Pandemie keine grundlegende Veränderung der familiären Aufgabenteilung, Rollenteilung, Ressourcenverteilung. Eine Revolution bei den Geschlechterrollen hat die Pandemie nicht gebracht.
Wie kann man eine erschöpfte Gesellschaft wiederbeleben?
Wir dürfen keine raschen Veränderungen erwarten: Wir haben uns drei Jahre lang mit der Pandemie beschäftigt und wir werden uns wahrscheinlich wesentlich länger mit den Folgen der Pandemie beschäftigen. Langfristige Auswirkungen, zum Beispiel auf Kinder und Jugendliche, sehen wir erst jetzt. Es gibt Bildungslücken, Probleme im Spracherwerb oder bei den Basis-Fähigkeiten, die Kinder zum Schreiben und zum Rechnen brauchen. Und wir sehen Probleme im psychischen Bereich, aber es gibt zu wenig Therapieplätze für Kinder und zu wenig kurzfristige, niederschwellige, flexible Angebote. Drittens sehen wir im sozialen Bereich, dass es Kindern in ihrer Entwicklung gefehlt hat, mit Gleichaltrigen interagieren zu können.
Österreich
Von rund 2,5 Mio. Familien leben 1,4 Mio. mit Kindern im Haushalt
Nachgefragt
Für die Studie "Corona und Familienleben" wurden 98 Eltern mit 181 Kindern im Kindergarten- oder Schulalter befragt. Die Erhebung begann in der ersten Woche des Lockdowns (16. März 2020) und endete im Frühjahr 2022. Hier weitere Infos: https://cofam.univie.ac.at/
1,135 Millionen
Schüler mussten im ersten Lockdown zu Hause unterrichtet werden
Wie werden wir mit der Eigenverantwortung umgehen?
Es ist normaler geworden, eine Maske zu tragen. In der Zeit vor der Pandemie hätte eine Maske bei einem Kindergeburtstag oder im Büro zu sehr verwunderten Kommentaren geführt. Jetzt würde man wohl nach dem Grund fragen. In der Studie haben wir gesehen, dass das Thema Impfen zu Konflikten innerhalb von Familien und auch in größeren sozialen Netzwerken wie Freundeskreisen geführt hat. Diese Streitigkeiten konnten teilweise bis jetzt nicht beigelegt werden.
Wie sehen die Familien die nahe Zukunft?
Zum Abschluss der Studie haben wir die Eltern im Frühjahr 2022 gefragt, was sie ihren Kindern wünschen. Und da stand Normalität im Vordergrund: Eine unbeschwerte Kindheit ohne Angst und Einschränkungen. Eltern bedauern, dass ihre Kinder einen großen Teil ihrer Kindheit oder Jugend verpasst haben und dass ihnen viele Erinnerungen an schöne Ereignisse, die man eigentlich in diesem Alter erlebt, fehlen.
Glauben Sie, dass das Denkmuster "nichts ist fix" zu den niedrigen Geburtenraten 2022 geführt hat?
Wir wissen aus anderen Epidemien und Krisensituationen, dass große Lebensentscheidungen eher aufgeschoben werden. Aber die Pandemie hat sehr lange gedauert, Krieg und Inflation sind hinzu gekommen, somit sind die Effekte, die wir auf diese Lebensentscheidungen sehen, auch nicht auf die Pandemie allein zurückzuführen.
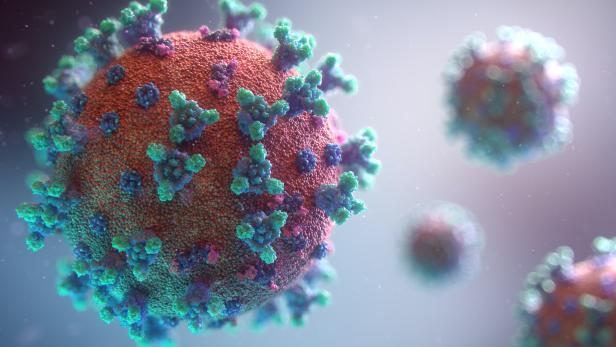


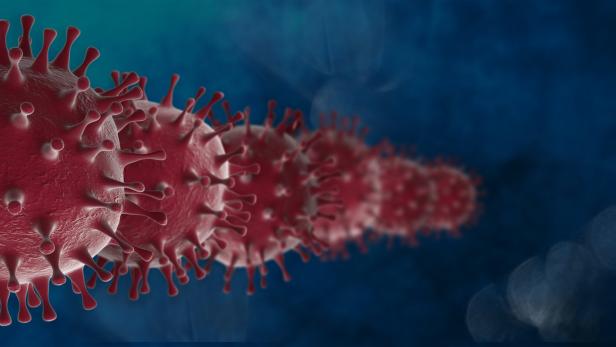


Kommentare