Corona: Wann ist das endlich vorbei?

Kaum hatte die Schlacht von Bosworth 1485 die Rosenkriege in England beendet, überwältigte eine entsetzliche Seuche das Land. Mitte des 16. Jahrhunderts verschwand der „Englische Schweiß“ so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Bis heute bleibt der Erreger ein Mysterium. – Ein Virus, das eines Tages einfach wieder weg ist? Das klingt nach der attraktivsten Variante, wie eine Pandemie enden könnte. Vor allem angesichts des derzeit meistbenutzten Stoßseufzers: „Wann ist das endlich vorbei?“
Doch: Kaum eine der großen Geißeln der Menschheit – und es gab viele – endete so abrupt. Gleichzeitig hatte aber auch keine die Welt dauerhaft im Klammergriff. „Epidemien lassen sich nicht über einen Kamm scheren“, weiß die Medizinhistorikerin Daniela Angetter von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Denn: „Pandemien sind so vielfältig wie die Erreger, die sie auslösen.“ Während manche Seuchen jahrhundertelang Schrecken verbreiteten, verschwinden andere Infektionskrankheiten scheinbar wie von selbst.
Das Ende einer Seuche ist ein komplexer, langsamer Prozess, der einer bestimmten Dramaturgie folgt. Und von Frustration und Erschöpfung begleitet wird, sagen zumindest Forscher. Welche Krankheiten wir ausrotten konnten, welche wir ausgetrickst haben und welche wir auch zukünfitg aushalten werden müssen, erfahren Sie in dieser Geschichte.
Ausrotten
Im Idealfall wird der Erreger ausgerottet, doch das ist ausgesprochen selten. Eradikation, die weltweite Ausrottung einer Krankheit, nennt es die Fachfrau. Angetter: „Das ist uns nur ein einziges Mal in der Geschichte gelungen – bei den Pocken. Sie konnten durch die Impfung eliminiert werden, 1980 verkündete die WHO: ,Die Welt ist pockenfrei.‘“
Die Pocken boten ideale Voraussetzungen für die Eradikation: Das Virus wurde nur von Mensch zu Mensch übertragen, während Corona und andere Viren tierische Zwischenwirte haben, in denen sie alle Maßnahmen aussitzen können. Zudem waren die Symptome so eindeutig, dass Infizierte leicht erkannt und isoliert werden konnten. Und: Einmal an den Pocken erkrankt und genesen, war man lebenslang immun.
Aushalten
Andere Pandemien haben bis heute nicht geendet – wir halten sie nur weiter aus, wenn auch nicht immer „einfach“.
Die Spanische Grippe treibt unter dem Namen H1N1-Virus nach wie vor ihr Unwesen.
Medizinhistorikerin
"Untergruppen haben in den 1960er- und 70er-Jahren Hongkong- und Asiatische Grippe ausgelöst. 2009/10 hat sie als Schweinegrippe 100.000 getötet“.
Austricksen
„Ab dem Zeitpunkt, in dem es wirksame Impfungen und Medikament gibt, ändert sich der Umgang mit Seuchen aber“, sagt Angetter und erinnert, dass wir jährlich Grippewellen hatten. „Das ist das ,soziale Ende‘ von Pandemien. Man findet sich damit ab, dass es diese Krankheiten gibt, lebt damit, arrangiert sich mit der Krankheit.
Ganz wichtig für das soziale Ende: „Die Angst nimmt ab. Das tut sie immer dann, wenn die Medizin eine Möglichkeit gefunden hat, mit der Krankheit umzugehen – egal, ob Impfung oder Medikamente. Die Methoden hängen von der Krankheit ab“, sagt Angetter und nennt HIV, das bis heute unheilbar, aber beherrschbar ist.
All das zeigt uns: Über die Frage, wie Seuchen entstehen und welche Folgen sie haben, ist die Welt vergleichsweise solide informiert. Das Ende einer Seuche dagegen ist ein komplexer, langsamer Prozess, dem Gesellschaftsforscher, Historiker, Mediziner und Politiker derzeit nachgehen. Sie spielen eine Reihe von Szenarien durch, wie Corona „enden“ könnte. „Dabei gibt es eine Art sozialpsychologischer Komponente, die mit Erschöpfung und Frustration zu tun hat“, sagte Naomi Rogers, Historikerin an der Yale-Universität, der New York Times.
Es ist denkbar, dass die Menschen irgendwann einfach beschließen: Jetzt reicht’s.
Historikerin
Sie wollen nicht permanent im Panikmodus leben – auch wenn das Krankheit und Tod mit sich bringt. Soziologen nennen das die „emotionale Epidemiologie“ einer Seuche. Die Tuberkulose beispielsweise tötet noch immer 1,5 Millionen Menschen jährlich – als „Pandemie“ aber wird sie kaum mehr anerkannt.
Schon 1989 meinte der renommierte US-Epidemiologe Charles E. Rosenberg, „Epidemics ordinarily end with a whimper, not a bang“ („Normalerweise enden Epidemien mit einem Wimmern, nicht mit einem Knall“). Sie haben als soziales Phänomen eine dramaturgische Form: „Eine Epidemie beginnt zu einem bestimmten Zeitpunkt, tritt räumlich oder zeitlich begrenzt in Erscheinung, führt dann zu zunehmenden Spannungen und wird zu einer Krise mit individuellem und kollektivem Charakter.“
Ankünden
Was uns wieder zum allgegenwärtigen Stoßseufzer „Wann ist das endlich vorbei?“ bringt. Und zu den vielen Experten, die der Überzeugung sind, dass es auch bei Corona keinen „plötzlichen Sieg“ geben wird. Auch die Medizinhistorikerin Angetter lässt sich keinesfalls auf einen Zeitpunkt für das Pandemie-Ende festnageln: „Da werden sie niemanden finden,“ meint sie. „Und das ist vor allem den Virusmutationen geschuldet.“
Bleibt nur, die Superforecaster zurate zu ziehen, jene kleine Gruppe von Laien, die in der Lage ist, das Weltgeschehen konstant besser zu prognostizieren als die breite Öffentlichkeit oder Experten – wohlgemerkt, ohne Zugang zu geheimen Informationen zu haben. Einer von ihnen, Roman Hagelstein, etwa erklärte der deutschen FAZ: Spätestens im Sommer sei „der Spuk vorbei. Dann werden wir wieder ein annähernd normales Leben haben.“
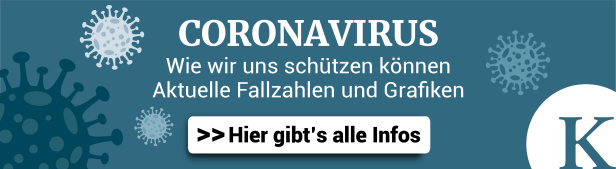







Kommentare