Krebs bei Kindern: Wie stark die Überlebenschancen gestiegen sind

An der St. Anna Kinderkrebsforschung will man „jeden Tag ein bisschen besser werden, weil unser Ziel
ein wichtiges ist und die Erkrankungen nicht warten“.
Zwei Millionen Knochenmarkszellen befinden sich in der eingefärbten Gewebeprobe auf einem Glasplättchen. Sie ist von einer kleinen Krebspatientin. Darüber fährt ein Mikroskop automatisch hin und her, scannt die Probe, nimmt ein Bild nach dem anderen auf. Nach zwei Stunden sind einzelne, grün leuchtende Punkte sichtbar: Tumorzellen. Künstliche Intelligenz wurde trainiert, diese Krebszellen zu erkennen – und wenn es nur eine in einer Million gesunder Zellen ist. Der Farbstoff ist so spezifisch, dass er nur Tumorzellen einfärbt.
„Natürlich überprüfen wir, ob es sich tatsächlich um Tumorzellen handelt“, sagt Sabine Taschner-Mandl von der St. Anna Kinderkrebsforschung: „Aber man kann sich vorstellen, wie lange das dauern würde, müssten wir das alles händisch auswerten.“
➤ Mehr lesen: Krebs: Wie kann eine optimale Versorgung weiterhin gewährleistet werden?
Die Probe stammt von einem Kind im benachbarten St. Anna Kinderspital, das an einem Neuroblastom – einem bösartigen Tumor des Nervensystems – erkrankt ist. Nur 24 Stunden dauert es insgesamt, bis das Ergebnis vorliegt – dann steht fest, ob sich im Knochenmark eine Metastase gebildet hat.
"Das Mikroskop kann von der Gewebeprobe auch 40 oder 50 Aufnahmen machen. Damit können wir sozusagen Landkarten von den Tumoren erstellen", sagt Taschner-Mandl. Damit ist es etwa möglich zu untersuchen, wie die Tumorzellen mit angrenzenden gesunden Gewebezelllen interagieren und aufeinander wirken.
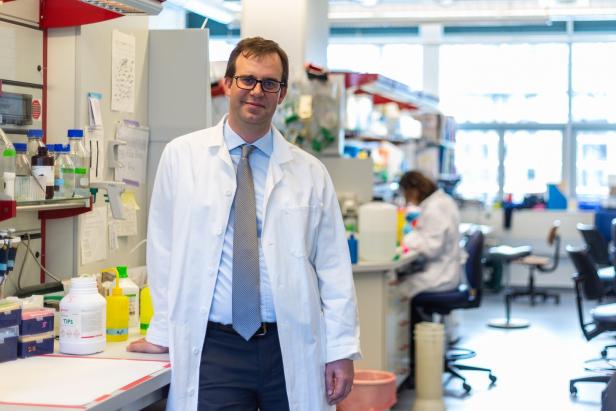
Kaan Boztug, wissenschaftlicher Direktor der St. Anna Kinderkrebsforschung.
Die vor 35 Jahren gegründete St. Anna Kinderkrebsforschung ist eines der weltweit führenden Institute auf dem Gebiet. „1988 war die Welt in der Kindkrebsforschung viel dunkler“, sagt der wissenschaftliche Direktor und Kinderarzt Kaan Boztug. „Damals lagen die Überlebensraten für Kinderkrebserkrankungen bei ungefähr 20 Prozent – das war katastrophal.“ Mittlerweile überleben 80 Prozent der Kinder ihre Krebserkrankung: „Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie Forschung in der Medizin zu enormen Fortschritten beitragen kann.“
Kinderkrebs
Jährlich erkranken in Österreich etwa 200 Kinder bis 14 Jahre und 100 Jugendliche an Krebs. Leukämien, Lymphome („Lymphdrüsenkrebs“) und Tumore des Zentralnervensystems sind am häufigsten.
Forschungsinstitut
Die St. Anna Kinderkrebsforschung in Wien-Alsergrund hat 250 Mitarbeitende und finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Kaan Boztung: "Ich bin wirklich dankbar dafür, dass wir von der Bevölkerung so getragen werden." Internet: kinderkrebsforschung.at
Viele Tumore, die bei Kindern auftreten, „gibt es bei Erwachsenen entweder gar nicht, oder sie unterscheiden sich biologisch erheblich“ – ein wesentlicher Grund, warum es ein eigenes Institut für Kinderkrebsforschung benötigt. Eine Grundlage für die Erfolge gegen Kindkrebs liege darin, dass Forschende und in Spitälern tätige Ärztinnen und Ärzte eng zusammenarbeiten.
➤ Mehr lesen: Kindermedizin: Wenn keine Diagnose möglich ist
Boztug betont, dass die Statistik zu den Überlebenschancen für die einzelnen Eltern nichts bedeutet: „Sie wollen, dass ihr Kind überlebt. Denn für jeden Patienten ist eine solche Erkrankung ein schreckliches Schicksal.“ Deshalb sei der Anspruch am Institut, „jeden Tag ein bisschen besser zu werden, weil unser Ziel ein wichtiges ist und die Erkrankungen nicht warten“. Und Boztug „will nach den Sternen greifen“: Eine Zukunftsvision sei, „Krebs am besten zu verhindern. Und wo wir das nicht können, wollen wir Erkrankungen und Rückfälle früher erkennen sowie schneller und besser therapieren“.
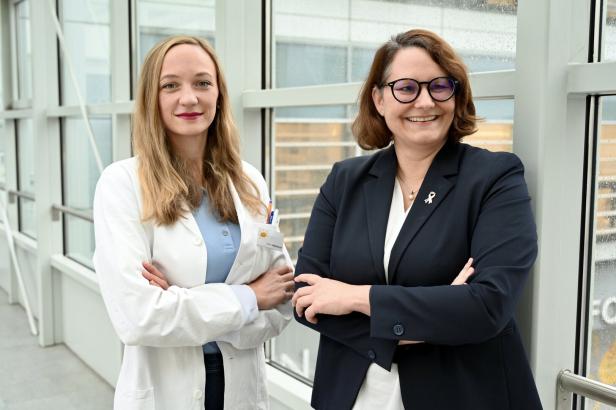
Marie Bernkopf (li.) und Sabine Taschner-Mandl haben als einen Forschungsschwerpunkt, in Blutproben kleine Stückchen des Erbmaterials von Tumoren nachzuweisen.
Ein Schritt in diese Richtung ist ein großes Forschungsprojekt, das im Jänner startete: Bisher wird bei Kindern mit Neuroblastom mit bildgebenden Verfahren und den geschilderten Knochenmarksuntersuchungen kontrolliert, ob ein Tumor nach der ersten Therapie neuerlich aufgetreten ist oder nicht. Das aber ist belastend für die Kinder. „Weniger belastend ist die Abnahme einer ganz kleinen Menge an Blut, um darin Erbgutstückchen (DNA) des Tumors nachzuweisen“, erklären die Molekularbiologinnen Sabine Taschner-Mandl und Marie Bernkopf.
„Flüssigbiopsie“
In einer Studie mit 24 europäischen Forschungszentren – unter wissenschaftlicher Leitung der St. Anna Kinderkrebsforschung – wird jetzt diese „Flüssigbiopsie“ anhand der Proben von 150 Patientinnen und Patienten in der klinischen Praxis getestet. Bewährt sie sich, könnten künftig Kontrolluntersuchungen, ob der Tumor wieder aufgetreten ist, engmaschiger durchgeführt werden – derzeit beträgt der Abstand drei Monate, um die Kinder nicht zu sehr zu belasten. Boztug: „Selbst wenn man die Erkrankung nur ein oder zwei Monate früher entdeckt, verbessert das wahrscheinlich die Überlebenschancen.“
Den Wissenschafterinnen Taschner-Mandl und Bernkopf ist es auch gelungen, die Diagnostik so zu optimieren, dass nur eine ganz kleine Blutmenge abgenommen werden muss: "Das ist besonders wichtig, weil ja die Kinder auch oft sehr klein sind und wir sie mit den Blutabnahmen nicht belasten wollen."
Modell einer Lunge
Wegweisend ist auch ein weiteres Projekt: Gegen die Lungenmetastasen eines sehr aggressiven Knochenkrebses (Ewing-Sarkom) gibt es nur wenige Medikamente – auch, weil es keine guten Möglichkeiten gibt, sie zu testen. Branka Radic-Sarikas und Heinrich Kovar haben deshalb aus Gewebeproben, die von anderen Patienten ohne Krebs ohnehin entnommen werden mussten, kleine Lungenmodelle (Organoide) aus Zellen entwickelt - sie enthalten alle wichtigen Zelltypen der Lunge, sagt Radic-Sarikas. In diese Lungenmodelle bringen sie Krebszellen ein und untersuchen, wie sie mit den Lungenzellen kommunizieren. Kovar: „Ziel ist, diese Kommunikation mit Medikamenten zu stören und die Metastasen zu zerstören.“ Die Lungen-Organoide würden wie Crashtest-Dummies funktionieren: "Wir versuchen damit, möglichst nahe an die tatsächliche Situation in Patienten heranzukommen." Die Organoidee bieten die Möglichkeit, die Auswirkungen von Medikamenten auf die Tumorzellen und deren Umfeld wiederzugeben.
Kommentare