Gewalt im Kreißsaal: "Es braucht wenig, um einer Frau die Würde zu nehmen"

„Es hat von Anfang an nicht gepasst“, beschreibt es die Tirolerin Laura im KURIER-Gespräch. Dabei war sie an jenem Oktobertag 2021 anlässlich ihrer Entbindung noch mit einem guten Gefühl ins Spital gegangen. Es sollte anders kommen – sie erlebte die Geburt als traumatisch, physisch und psychisch gewaltvoll und übergriffig. So auch, als ihr nach über 24 Stunden Wehen, ohne Vorwarnung, ohne Aufklärung, von der Hebamme die Fruchtblase aufgestochen wurde. Ein weiterer Tiefpunkt in der Geschichte einer Geburt, die von fehlendem Respekt und Empathielosigkeit geprägt war.
Damit ist Laura nicht alleine. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält in einer Erklärung aus dem Jahr 2015 fest, dass „viele Frauen in aller Welt in geburtshilflichen Einrichtungen eine missbräuchliche und vernachlässigende Behandlung erfahren“. Genauere Angaben zu machen ist schwer, erklärt auch Marianne Mayer, Leiterin des Wiener Hebammengremiums: „Es gibt zu diesem Thema keine offizielle Zahl an Betroffenen in Österreich, da Frauen mit ihren Erfahrungen selten an die Öffentlichkeit gehen. Außerdem gibt es keine allgemeine Definition des Begriffs ,Gewalt im Kreißsaal’. Die einen nehmen schon ein schroffes Wort als Gewalt wahr, für andere ist es etwa die Saugglocke.“
Die Wienerin Marlene musste bei ihrer Geburt im Oktober 2020 beides erleben. Beim Vorbereitungskurs im öffentlichen Krankenhaus, in dem sie sich angemeldet hatte, hatte sie sich noch bestens aufgehoben gefühlt. Die Bedenken der anwesenden Frauen, die die Geburt ohne Wahlhebamme bestreiten mussten, wurden zerstreut, eine Eins-zu-eins-Betreuung quasi garantiert. Angesichts aktueller Zahlen ein vollmundiges Versprechen: In Wien kommen auf knapp 550 Hebammen im Jahresschnitt 20.000 Neugeborene. „Hebammen versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, werdende Mütter zu unterstützen. Wenn aber eine Hebamme zwei oder drei Frauen gleichzeitig betreut, hat sie keine Zeit, sich wirklich auf die Patientinnen einzulassen“, sagt Mayer.
Körperverletzung
Was Marlene im Rahmen ihrer Geburt erleben musste, verfolgte sie noch lange.
Nach mehreren Stunden starker Wehen, in denen sie die meiste Zeit sich selbst überlassen war, ging, wie sie sagt, der richtige Horror erst los: „Die Presswehen haben begonnen. Ich war dazu in den unterschiedlichsten Positionen, bis sie mich dann schließlich doch wie einen Käfer auf den Rücken gedreht haben. Die Ärztinnen haben gemeint (Babysprache): ,Wir werden jetzt ein bissi mithelfen, gell?’ Eine hat sich hinter mich gestellt und hat mit voller Wucht auf meinen Bauch gedrückt, zwei Hebammen haben meine Beine festgehalten.“ Als die andere Ärztin mit der Saugglocke nachhalf, kam Marlenes Tochter schließlich zur Welt.
„Meine erste Reaktion war nur, endlich ist sie da und es ist alles gut. Ich habe nicht wirklich mitgekriegt, wie sie mich genäht haben. Ich habe nur gehört (Babysprache): ,Scheidenriss, Dammriss, eh nicht so schlimm.’“ Das war es dann aber leider doch. Nicht nur war die Naht, wie sich herausstellte, schief, ihr war auch der Scheideneingang ein Stück zugenäht worden. An einer Operation, nur wenige Monate nach der Geburt, führte kein Weg vorbei. Als Retraumatisierung bezeichnet Marlene das heute. „Ich hatte so schlimme Panikattacken und Angstzustände wie noch nie zuvor.“ Später wurde ihr eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert.
Es sollte nicht der einzige Schock bleiben. Starke Steißbeinschmerzen, vom Spital als „normal“ abgetan, hatten ihr bereits unmittelbar nach der Geburt zu schaffen gemacht. Nachdem sie auch daheim nicht aufhörten, brachte schließlich ein MRT (Magnetresonanztomografie) Gewissheit: Gebrochenes Kreuzbein. Geschehen beim von Marlene eindrücklich beschriebenen „Kristeller-Handgriff“, bei dem starker Druck auf den Bauch der Gebärenden ausgeübt wird: Eine Intervention, von der die WHO ausdrücklich abrät, da „es dabei ernste Bedenken bezüglich des Gefahrenpotenzials für Mutter und Kind“ gebe.
Die WHO sagt es deutlich: „Jede Frau hat das Recht auf den bestmöglichen Gesundheitsstandard. Dies beinhaltet das Recht auf eine würdevolle und wertschätzende Gesundheitsversorgung.“ Viele Frauen machen aber ganz andere Erfahrungen. Gewalt unter der Geburt hat dabei verschiedene Facetten.
Physische Gewalt:
Dazu zählt unter anderem: Festhalten, keine freie Wahl der Geburtsposition, grobe Behandlung, Medikamentengabe ohne oder mit unvollständiger Aufklärung, die Durchführung eines Dammschnitts ohne Einverständnis und medizinische Notwendigkeit.
Psychische Gewalt:
In diese Kategorie gehört das Ausüben verbaler Gewalt, etwa durch Drohungen oder abschätzige Bemerkungen, Anschreien, alleine lassen, Machtmissbrauch und Willkür. Auch sexualisierte Sprache und Witze fallen hier hinein.
Strukturelle Gewalt:
Dazu gehören fehlende Raumkapazitäten oder Personalmangel, etwa die Hebammenunterversorgung. All diese Faktoren führen dazu, dass Frauen ihre Geburt nicht als gewaltfrei erleben. Mit potenziell langfristigen Folgen: Von Schmerzen bis zu schweren Verletzungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Auch die Mutter-Kind-Bindung kann unter dem erlebten Trauma leiden.
Aktivismus, Austausch:
Jedes Jahr am 25.11. legen Frauen im Rahmen der globalen Aktion „Roses Revolution“ symbolisch eine Rose vor das Krankenhaus, in dem sie schlechte Erfahrungen machen mussten. Auf der Facebookseite der Bewegung teilen sie ihre Geschichten, auch wo sie diese erlebt haben, und machen so auf das Problem aufmerksam.
Respektvoll
Definitiv gehört sie nicht zu der von der WHO eingeforderten „Respektvollen Entbindungspflege“. Zu deren Forderungen zählt auch das Mitspracherecht der Frau bei der Behandlung: Etwas, das Laura großteils vorenthalten wurde. Nicht nur wurde ihr Lachgas verabreicht, als sie dachte, Sauerstoff zu bekommen, die Fruchtblase einfach aufgestochen und der Wehentropf gegen ihren Willen voll aufgedreht. Auch beim Kaiserschnitt, der letztendlich ungeplant durchgeführt wurde, nahm man ihr die Entscheidung einfach ab: „Die Hebamme hat aufs CTG geschaut und gefragt, ob ich jetzt doch einen Kaiserschnitt will. Ich habe kurz überlegt. Und da hat sie schon gesagt: ,So, dann entscheide ich das jetzt. Wir machen einen.’“
Tabus brechen
Nach der Geburt, zurück auf der Mutter-Kind-Station, ging die psychische Gewalt weiter: „Die Nachtschwester ist gekommen und hat gesagt: ,Du kannst dich eh nicht um dein Kind kümmern, ich nehme es jetzt mit.’ Man ist ja überschwemmt von Hormonen, ich habe dann geweint und geschluchzt: ,Ich will aber mein Baby!' Da hat sie mich nur eiskalt angeschaut und gesagt: ,Jetzt hören Sie sofort auf zu weinen, sonst reißt die Narbe und wir können Sie notoperieren.’ Das war für mich die schlimmste Nacht meines Lebens.“ Ähnlich empfand auch Marlene die Tage nach der Geburt: „Ich wollte nur noch heim. Mich hat dort keiner angeschaut, keiner gewaschen, die haben sich null interessiert - auch psychisch, obwohl ich dort wirklich nur am Weinen war und die Schmerzen auch nicht weniger geworden sind.“
Beide sagen heute, dass eine adäquate Geburtsvorbereitung ihnen sehr geholfen hätte – sowohl, was den physiologischen Vorgang der Geburt, als auch die eigenen Rechte als Patientin betrifft: „Es braucht einen einheitlichen Standard für die Kurse und eine viel bessere Aufklärung über mögliche Interventionen, etwa einen ungeplanten Kaiserschnitt“, sagt Laura. Generell, sind sie sich einig, wird viel zu wenig über das Thema gesprochen, es scheint auch heute noch ein Tabuthema zu sein. Frage man aber bei anderen Müttern nach, hätten viele ähnliche Geburtsgeschichten zu erzählen, sagt Marlene.
Eines möchte sie betroffenen Frauen unbedingt mitgeben: „Selbst wenn man so etwas Schreckliches erlebt, wenn man wirklich gute Hilfe bekommt, kann man die Geschichte gut ins Leben integrieren. Das ist jetzt einfach meine Geschichte. Ja, es ist ein schwerer Start ins Leben mit Kind – aber man ist nicht für immer davon gezeichnet.“
Die vollständigen Gesprächsprotokolle der beiden Frauen können Sie hier nachlesen. Anmerkung: Es folgen ungeschönte Erzählungen der Entbindungen und ihrer körperlichen Auswirkungen.
Jede Frau hat ja cirka die gleiche Vorstellung von der Geburt. Man weiß, es wird kein Zuckerschlecken, es wird wehtun. Aber ich habe mir immer vorgestellt, dass da Hebammen sind, die einen anleiten. Viel mehr habe ich mir da eigentlich gar nicht erwartet. Ich war prinzipiell euphorisch, man wartet ja doch neun Monate auf das neue Leben.
Meine Schwangerschaft ist komplikationsfrei verlaufen. Ich wollte zur Geburt in ein Krankenhaus, bei meinem war dann auch eine Kinderklinik in der Nähe - einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Es war dann Oktober 2021. Mein Mann und ich sind dann ins Spital gefahren, weil ich einen Blasensprung hatte, Wehen hatte ich noch keine. Dafür kann die Klinik nichts, aber es war ja Corona und mein Mann hat heimfahren müssen, während ich stationär aufgenommen wurde.
Es hat von Anfang an nicht gepasst. Mir ist nicht zugehört worden. Ich hatte aber noch Vertrauen. Wenn die im Krankenhaus sagen, ich soll da bleiben und nach 12 Stunden wird eingeleitet, dann wird das schon stimmen, habe ich mir gedacht. Mein Mann war untertags noch kurz zu Besuch, danach wurde ich eingeleitet. Das geschieht mit so einer Art Tampon, auf dem ein Mittel ist, das die Wehen verursacht. Ich habe da schon gesagt, das tut so weh, das ist kaum auszuhalten. Die Schwester meinte nur, das müsse ganz nah zum Muttermund, "da musst du jetzt halt durch, andere Frauen halten das auch aus".
Für mich persönlich war das richtig schlimm. Man ist alleine in dem Zimmer, hört andere Frauen schreien. Man weiß nicht was los ist, es kommt keiner schauen, mein Mann ist nicht da. Es wurde einfach gewartet, dass sich der Muttermund öffnet. Wenn ich nicht geläutet habe, ist niemand gekommen, um nach mir zu schauen. Die ganze Zeit hatte ich Schmerzen, die ganze Zeit Wehen. Fast drei Stunden war ich an das CTG (Wehenschreiber) angeschlossen, weil niemand gekommen ist, es zu entfernen. Normalerweise bleibt es etwa eine halbe Stunde drauf. Dabei musste ich die ganze Zeit still auf der Seite liegen. Dann ist endlich jemand gekommen. Dieser Druck auf dem Bauch, zusätzlich zu den Wehen, das schmerzt schon mit der Zeit.
Gegen ein Uhr in der Früh meinte die Hebamme, ich kann in den Kreißsaal, dann kann auch mein Mann kommen und und ich darf in die Wanne, damit die Schmerzen erträglicher werden. Sie ist dann einfach mit meiner Tasche vorausgerannt und ich bin langsam hinten nach und hab mich dann gefragt: "Scheiße, wo ist der Kreißsaal?" Im Saal habe ich dann das Bedürfnis gehabt, das Becken zu kreisen. Die Hebamme hat mich ausgelacht und gefragt, was ich da mache. Da bin ich mir dann total dumm vorgekommen, wie so ein Schulmädchen, dass nicht weiß, was sie da macht. Dabei wollte ich einfach nur stehen und das Becken kreisen und versuchen, durch die Bewegung die Wehen besser zu ertragen. Ich bin dann aufs Bett geklettert, weil ich mir gedacht habe: "Ok, dann mache ich das anscheinend falsch." Sie ist bei mir sitzengeblieben und hat mich beobachtet. Das war wie bei einer Prüfung, wenn die Kommission vor einem sitzt und quasi zu verstehen gibt: "Mach was".
Es ist dann eine Zeit recht gut gegangen. Als mein Mann dann da war, hats geheißen, sie bringt mir etwas, damit ich besser atmen kann. Ich hatte eigentlich keine Atemprobleme. Dann nach den ersten drei, vier Atemzügen habe ich gemerkt, das ist kein Sauerstoff, das ist Lachgas. Und da wars bei mir mit der Konzentration vorbei (beginnt zu weinen, Stimme bricht), da habe ich die Wehen dann gar nicht mehr ausgehalten. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Maske nicht genommen, ich habe dadurch sogar halluziniert. Ich war mir ganz sicher, mein Mann hat zu der Hebamme gesagt: "Mach was, meine Frau stirbt". Das hat er aber nie gesagt. Aber für mich war das so real, ich habe selbst geglaubt, ich sterbe.
Dann irgendwann war das Gas wieder weg. Sie hat eine vaginale Untersuchung gemacht - das war recht oft, das hat irgendwann mehr wehgetan als wie die Wehen selbst. Sie hat die Untersuchungen teilweise während der Wehen durchgeführt. Dann hat sie sogar die restlich verbleibende Fruchtblase ohne Vorwarnung, ohne Aufklärung, eröffnet. ich habe nur plötzlich gemerkt, wie etwas Warmes aus mir herausrinnt und dachte, das ist Blut. Ich habe meinen Mann gefragt, was los ist. Dann hat die Hebamme nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, "Ja, ich hab' jetzt die Fruchtblase aufgestochen".
Irgendwann war Schichtwechsel, das war aber nicht wirklich besser. Muss auch dazusagen, ich weiß gar nicht genau, ob die Zeitleiste so stimmt, es ist teilweise ziemlich verschwommen. Irgendwann ist die neue Hebamme nervös geworden. Dann war plötzlich auch eine Ärztin da, mir wurde aber nicht gesagt, was los ist. Sie haben immer wieder aufs CTG geschaut und gesagt, es steht ein Kaiserschnitt im Raum, weil beim Baby die Herztöne immer wieder abfallen. Aber es sei noch nicht so schlimm, sie erholt sich immer wieder. Ich habe dann gesagt: "Bitte macht einen Kaiserschnitt, weil ich will mich selbst dazu entscheiden und keinen Notkaiserschnitt riskieren". Ich habe geweint. Sie haben mir aber einen Kaiserschnitt verweigert und gemeint "Du wolltest so dringend vaginal gebären, wir warten wir noch ein bisschen zu". Ich wollte mich aber selbst dazu entscheiden können.
Es hat dann noch einige Zeit gedauert, die Herztöne sind immer wieder abgefallen. Irgendwann ist dann die Hebamme im Zimmer gestanden und hat gesagt: "So, jetzt müssen wir aber weitertun, weil die Zeit ist um". Dann hat sie den Wehentropf voll aufgedreht und ich habe gesagt: "Bitte nicht, ich weiß nicht, ob ich das aushalte". "Nein, aber die Uhr tickt". Nachdem sie den Tropf aufgedreht hat, habe ich trotz PDA (Periduralanästhesie) so starke Schmerzen gekriegt, dass ich das Gefühl hatte, es katapultiert mich vom Bett runter. Dann hat sie aufs CTG geschaut und gefragt, ob ich jetzt doch einen Kaiserschnitt will. Ich habe kurz überlegt. Und da hat sie schon gesagt: "So, dann entscheide ich das jetzt. Wir machen einen Kaiserschnitt".
Sie haben mich also aufs andere Bett gehoben haben und in den OP geschoben, währenddessen hat mich die Operateurin mehr schlecht als recht aufgeklärt, meinen Mann haben sie weggeschickt. Im OP hat dann alles gepasst, ich hatte auch einen netten Anästhesisten. Aber der Umgang nach dem Kaiserschnitt war wirklich schlimm. Man bekommt das Baby nur kurz Kopf an Kopf, ist ans Bett angeschnallt. Nach dem Zunähen waren auf einmal mein Mann und mein Kind weg, mir wurde nicht gesagt warum. Ich war ja wach während dem Kaiserschnitt - es sind ja nur der Unterleib und die Beine betäubt.
Ich bin dann aber nach 35 Stunden Geburt doch eingeschlafen, nach zwei Stunden aufgewacht und habe sofort nach meinem Baby gefragt. Mir wurde gesagt, ich darf erst zu meinem Baby, wenn ich die Beine bewegen kann. Mir hat niemand sagen können, wie es meiner Tochter geht. Ich habe dann so stark drauf beharrt, dass sie dann irgendwann doch nachgegeben haben. Ich bin in ein leeres Zimmer gekommen, dann haben sie meinen Mann mit unserem Baby geholt. Dann haben sie sie ihm abgenommen und ich habe mir gedacht, ich kann mein Kind jetzt endlich halten, aber sie haben sie ins Bettchen gelegt. Sie hat bis dahin nichts zum Trinken bekommen, ich war richtig entsetzt.
Die psychische Gewalt ist dann auf der Mutter-Kind-Station weitergegangen. Die Nachtschwester ist zu mir gekommen und hat gesagt: "Du kannst dich eh nicht um dein Kind kümmern, ich nehme sie jetzt mit". (wiederholt langsam) "Du kannst dich eh nicht um dein Kind kümmern." Ich wollte in der Nacht mein Baby wieder haben, mir wurde gesagt, sie schläft und ich solle jetzt auch schlafen. Man ist ja überschwemmt von Hormonen, ich habe dann geweint und geschluchzt: "Ich will aber mein Baby". Dann hat mich die Schwester nur eiskalt angeschaut und gesagt: "Jetzt hören Sie sofort auf zu weinen, sonst reißt die Narbe und wir können Sie notoperieren." Das war für mich die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich hab gewusst, mein Baby ist da draußen, ich muss nur aufstehen, aber ich habe nicht aufstehen können. Logisch, die Situation ist fürs Pflegepersonal total stressig. Aber ich habe das Gefühl, meine Hilfsbedürftigkeit wurde so stark ausgenutzt. Es gibt noch viel schlimmere Geburtsgeschichten als meine, das weiß ich, aber es reicht wenig, um einer Frau die Würde zu nehmen.
Bei der Entlassung ist eine Mitarbeiterin zu mir gekommen und meinte, ich soll mir keine Gedanken machen, das war zwar eine schwere Geburt, aber sie hätten alles richtig gemacht. Ich habe später den Geburtsbericht angefordert und war richtig entsetzt. Es ist weder das Eröffnen der Fruchtblase dokumentiert gewesen, noch die Gabe vom Lachgas und auch nicht, dass sie die PDA zweimal haben stechen müssen. Er war total lückenhaft. Auch mein Mann hat gesagt: "Da steht ja die Hälfte nicht drinnen." Ich habe versucht, das dem Krankenhaus rückzumelden. Mir wurde nur gesagt, sie haben das dokumentiert was sie haben dokumentieren müssen.
Ich habe dann noch sehr lange von der Geburt geträumt. Dass es nicht vorbei ist, dass ich noch in den Wehen liege und das Baby noch in meinem Bauch ist. Richtige Albträume. Ich habe mir auch selber Vorwürfe gemacht. Mir wurde das in meiner Kindheit immer so vermittelt, dass jede Frau dafür gemacht ist, ein Kind zu kriegen und das auch kann - also vaginal. Auch im Geburtsvorbereitungskurs war nie die Rede von einem Kaiserschnitt, dass der notwendig werden kann. Man hat einfach keine Gedanken daran verschwendet. Ich habe mir oft gedacht: "Habe ich etwas falsch gemacht? Hätte ich irgendetwas anders machen sollen?" Für meinen Mann war es auch sehr schwer. Ich hatte den Babyblues, war fertig und habe viel geweint und dadurch, wie die Geburt gelaufen ist, dass das so übergriffig war, war das alles noch verstärkt. Für ihn waren die ersten drei Monate die Hölle auf Erden.
Ich habe schon lange gebraucht, bis ich das Mutterglück gespürt hab. In der ersten Zeit habe ich nur funktioniert. Man trägt, stillt, badet das Baby. Es war aber sehr schwer für mich, eine Bindung aufzubauen. Mittlerweile ist sie über ein Jahr alt und jetzt passt es echt gut.
Auf Instagram bin ich auf die "Kaiserschnittmamis" gestoßen. Das sind zwei Mütter, die Kurse anbieten, wo man über das Erlebte reden kann. Wo einem auch genau die Zusammenhänge und körperlichen Vorgänge erklärt werden. Wie Wehen wirklich ablaufen, und warum man sich wohlfühlen muss, dass sie funktionieren. Wie man den normalen Geburtsvorgang unterstützen kann, und solche Dinge. Es ist viel erklärt worden, was einem in der Klinik, während der Geburt, natürlich nicht erklärt wird. Mir hat das geholfen zu verstehen, dass bei mir brutal viel interveniert worden ist. Zu erkennen: Es ist ok, ich hab' nichts falsch gemacht und für das wie es gelaufen ist, ist es gut gelaufen. Ich habe auch eine Gesprächstherapie gemacht. Es war mir wichtig, mit einer außenstehenden Person darüber zu sprechen, der man auch alles erzählen kann.
Für die Zukunft habe ich für mich eine Zusatzversicherung abgeschlossen, damit ich bei einem zweiten Baby in eine Privatklinik gehen kann. Und zwar mit meiner eigenen Gynäkologin und eigenen Hebamme, die ich schon vor der Geburt kennenlerne und die genau wissen, was ich will und was nicht, und das dann auch so machen - natürlich unter der Voraussetzung dass alles beim Baby und mir alles passt - und die meine Vorgeschichte kennen.
Ich finde, Geburtsvorbereitungskurse sollten einen einheitlichen Standard bekommen. Es braucht bessere Aufklärung vor der Geburt, dass man aufgeklärt wird, dass es zum Beispiel zu einem Kaiserschnitt kommen kann. Es sollte auch ein Bewusstsein dafür geben, dass das eine große Bauch-OP ist, bei der erwartet wird, dass sich die Frau nach einer Woche um einen Säugling kümmern soll - ohne dass eine Physiotherapie folgt oder mehrere Kontrollen vorgesehen sind.
Dass die Schmerzen von Frauen nicht wirklich ernstgenommen werden, diese Erfahrung habe ich als Endometriosepatientin schon vor der Geburt gemacht - aber oft auch von anderen Frauen. Da wird das oft heruntergespielt, "ja, ein Kaiserschnitt ist ja nicht so schlimm". Schmerz ist aber ein persönliches Empfinden. Es macht meiner Meinung nach einen Riesenunterschied, ob man einen geplanten Kaiserschnitt hat, oder dieser nach vielen Stunden Wehen durchgeführt wird. Es ist wichtig, dass man offen darüber sprechen darf und das dann auch von anderen nicht runtergespielt wird.
Ich bin mit einer sehr positiven Einstellung in die Geburt gegangen. Ich hatte eine einfache Schwangerschaft, und habe mir gedacht: "Das wird schon klappen - und, falls es doch ein Problem gibt, bin ich in einem Krankenhaus, wo man weiß, was zu tun ist." Ich war vorab auch offen für Schmerzmitteln, PDA und auch einen Kaiserschnitt. Wenn es so sein soll, dann soll es sein. Der Geburtsvorbereitungskurs fand an einem Wochenende in meinem Krankenhaus statt. Die Hebammen haben die Geburt total niedlich dargestellt. "Macht gar nichts, wenn Sie keine Wahlhebamme haben", haben sie uns gesagt, "unsere Hebammen sind total sensibel und gehen individuell auf jede Frau ein." Sie haben auch unsere Bedenken und Ängste zerstreut, z.B. vor dem Kristellerhandgriff (Umstrittene Methode, dabei wird in der Austreibungsphase der Geburt wehensynchroner, starker Druck auf den Bauch der Frau ausgeübt). Sie haben uns beruhigt, der werde gar nicht mehr angewendet, bzw. immer versucht zu vermeiden. Ich habe mich danach richtig gut aufgehoben gefühlt.
Es war im Oktober 2020, ich hatte schon einige Tage Vorwehen und Senkwehen. In der Nacht ist der Schleimpfropf abgegangen, und in der Früh Fruchtwasser herausgetröpfelt. Mein Freund und ich sind dann am Sonntag, den 18.10. hingefahren. Er musste aber wegen der Coronasituation gleich wieder gehen. Ich war mit drei Frauen in einem Raum, gegen Abend sind die Wehen stärker geworden und in der Nacht dann stündlich immer schlimmer. Ich musste dann immer vorgehen zum Schwesternzimmer und sagen, dass die Wehen stärker werden. Das habe ich auch so gemacht. Die Schwestern sind kaffeetrinkend und lachend dagesessen und haben gesagt: "Erstgebärende? Na, das dauert noch Stunden!" Da bräuchte ich gar nicht mehr vorkommen.
Ich bin dann also wieder zurückgewatschelt, sie haben gesagt, ich soll schlafen. Ich hatte aber solche Schmerzen, habe ihnen gesagt: "Ich kann nicht schlafen". "Na, dann soll ich herumgehen." Ich bin dann also am finsteren Gang auf- und abgegangen. Null persönliche Betreuung. Gegen zwei Uhr früh habe ich gesagt, dass ich es gar nicht mehr aushalte. Dann haben sie mich in eine warme Dusche gestellt. Da bin ich dann ewig allein gestanden, bis mein Kreislauf ganz schwach war. Sie haben mir dann eine Schmerzinfusion gegeben und gemeint, dann werde ich schlafen können - ohne Info, was das genau ist. Ich bin dann weggekippt, als hätte ich einen Vollrausch und dementsprechend wieder aufgewacht. Nach vielleicht zwei Stunden dösen, wo man eh den Schmerz die ganze Zeit spürt.
Da wars dann vorbei. Mir war so schlecht und schwindelig, weil das einfach ein vollgas arges Schmerzmittel war. Da hat dann der richtige Horror begonnen. Es ist eine Hebamme ins Zimmer gekommen, die hat sich auf ein Stockerl gesetzt, mich angeschaut und gesagt (schnippischer Ton): "Na, das wird noch dauern! Oder wie hast du dir das vorgestellt?" Wie so eine richtige Hexe. Und ich war schon da verzweifelt. Ich habe ihr gesagt: "Mir ist urschlecht." "Na ja, was soll ich da jetzt machen?" Dann hab ich ihr vor die Füße gespieben, da hat sie auch nur zugeschaut. Ich mich sicher 15-, 20-mal übergeben, weil mir so schlecht war von diesem Mittel und hatte ein starkes Dröhnen in den Ohren. Als hätte ich Migräne, Grippe und Wehen, alles auf einmal. Dann habe ich gefragt, ob mein Freund endlich dazukommen darf, sie meinte (schnippisch): "Nein, also das sage ich, wann er das darf." Sie hat mich auch mein Handy nicht holen lassen, ich konnte ihm nicht einmal Bescheid geben.
Dann habe ich endlich in den Kreißsaal dürfen. Sie hat mich alleine hingeschickt, ohne meine Sachen. Das war ein ganz schlimmer Punkt. Ich habe mich an dem depperten Seil, dass da hängt, festgekrallt und habe nur gehofft, nicht zu sterben. Es war so schlimm, ich hatte Wehenstürme ohne Pause, mir war heiß und kalt. Dann habe ich endlich meinen Freund dazu holen dürfen, hat natürlich auch gedauert, bis er da war. Er hat mich da schon in einem absolut furchtbaren Zustand vorgefunden. Ich habe nur geweint und war völlig verzweifelt. Ich habe ja überhaupt nicht gewusst was los ist.
Dann hat mich die Hebamme in die halb kalte Badewanne gesetzt und hat gemeint, nur sie darf warmes Wasser aufdrehen. Sie hat einfach ärgstens ihre Macht ausgespielt, das war wirklich unglaublich. Sie hat auch Geschichten erzählt, dass sie schon öfter Frauen schreiend vom Klo geholt hat, die sich dort verstecken wollten, "aber da kann man sich nicht verstecken. Alle glauben, ja, sie kriegen ein Baby und das ist das Ärgste, aber es wird ja nur noch viel schlimmer - weil mit den Kindern, das ist nie so, wie man sich das vorstellt". Und das alles, während ich im eiskalten Wasser Wehen hatte, bis ich dann nur gescheppert habe und mein Freund meinte, sie sollen mich da einmal rausholen.
Der ganze Montag war so, wir waren mit dieser Frau die ganze Zeit im Kreißsaal. Ich habe auch immer wieder gefragt, wo ich gerade stehe - das hat man uns nämlich im Kurs versprochen, (salbungsvoll nachäffend), dass man uns immer genau sagt, wo wir stehen auf dieser Reise, diesem Wanderweg. Ja, wo steh ich denn jetzt auf dieser verdammten Reise?? Erst um 18.00 Uhr hat sie den Muttermund kontrolliert, und gesagt: "Naja, zwei Finger, da passt noch kein Köpfchen durch." Das hat mich komplett fertig gemacht. Ich habe verzweifelt gefragt, warum das bei mir so lange dauert. Sie: "Eine müde Mutter hat eine müde Gebärmutter. Das Baby bemüht sich eh, aber du musst dich halt auch bemühen." Der Spruch hat sich auch eingebrannt in meinem Kopf.
Gott sei Dank, dann war Schichtwechsel. Es sind dann zwei ganz junge Hebammen gekommen, die waren sehr nett, aber halt auch sehr unerfahren, die eine war sogar noch Studentin. Die haben einen Arzt geholt, weil sie meinten, das Baby liegt nicht so gut, und außerdem ist Fruchtblase noch gar nicht geplatzt. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich bis auf die Schmerzinfusion nichts angeboten bekommen. Ich habe dann gefragt, ob ich einen Kaiserschnitt brauche? Weil wenn es so ist, dann ist es so.
Ich habe dann eine PDA bekommen, die wurde dreimal verstochen. Dann hats endlich gewirkt. Dann haben sie mich turnen lassen - nach so vielen Stunden in den Wehen! - bis die Fruchtblase platzt. Dann kamen die Presswehen. Ich war dazu in den unterschiedlichsten Positionen, bis sie mich dann schließlich doch wie einen Käfer am Rücken gedreht haben. Dann musste es auf einmal schnell gehen. Zwei Ärztinnen, haben gemeint (Babysprache): "Wir werden jetzt ein bissi mithelfen, gell?" Eine hat sich hinter mich gestellt und hat mit voller Wucht auf meinen Bauch gedrückt, zwei Hebammen haben meine Beine gehalten. Dann sagt die andere Ärztin (Babysprache): "Schau, ich hab da so ein Huterl, das steck ich dir jetzt hinein". Auf einmal geht es RATSCH. Ich habe es reißen gespürt, ich habe es reißen GEHÖRT, wie die mir diese Saugglocke reingerammt haben. Dann wurde noch einmal kristellert, dann war endlich meine Tochter draußen.
Meine erste Reaktion war nur, endlich ist das Kind draußen und es ist alles gut. GOTT SEI DANK hatte ich dieses starke Gefühl "Mein Baby ist da!". Und habe nicht wirklich mitgekriegt wie sich mich genäht haben. Ich habe nur gehört (Babysprache): "Scheidenriss, Dammriss, eh nicht so schlimm."
Eine Hebamme hat mir Tee gebracht. Dann hats geheißen, sie lassen uns jetzt einmal zur Ruhe kommen. Wir sind also ewig im Kreißsaal herumgelegen, dann ist jemand gekommen: "Ihr müssts da jetzt gehen, wir müssen saubermachen." Ich: "Ich kann nicht gehen, ich habe mörderische Schmerzen, mir ist immer noch schwindlig und schlecht." Mir war eiskalt, ich habe gezittert am ganzen Körper, war kasweiß. Ich solle aufstehen und soll mein Baby tragend ins Zimmer gehen. "Ich hab aber solche Schmerzen." Jaja, das sei ganz normal. Dann haben sie mich mit so einem Sessel rübergefahren, mein Freund musste nach Hause gehen.
Ich bin dann nackt, in diesem ganzen Geburtsschlatz mit dem nackten Baby im Bett gelegen, mit mörderischen Schmerzen. Dann habe sie gesagt, ich soll Lulu machen gehen. Ich wieder: "Ich hab solche Schmerzen, auch beim Steißbein, ich kann mich nicht mal aufsetzen." Ich musste dann aber in dem Zustand mit dem Säugling am Arm ins Bad gehen. Es ging aber nicht, mein Beckenboden war wie taub. Sie machen also einen Ultraschall und sehen, ich habe über einen Liter Flüssigkeit in der Blase - was ich aber nicht gespürt hab. Dann habe ich einen Katheter bekommen und bin vor lauter Erschöpfung eingeschlafen.
Als ich nach ein paar Stunden aufgewacht bin, sind die Schmerzen erst so richtig losgegangen. Ich habe den Schwestern gesagt, dass sich die Schmerzen im Steißbein nicht normal anfühlen, es knackt auch komisch. "Na, das ist normal." - "Aber dass ich die Blase nicht spüre ist auch normal?" - "Jaja, ganz normal." Die erste Nacht habe ich nur geweint, war voll traumatisiert. Ich habe nur mein Baby an mich gedrückt und hatte das Gefühl, ich muss immer noch ums Überleben kämpfen.
Am nächsten Tag ist eine Schwester dahergekommen, die nur gemeint hat: "Na, was plärrstn so?" Und wegen dem Stillen, da sind sie sich auch nicht sicher, ob sie nicht vielleicht zufüttern müssen. Ich habe mich gewundert, sie hat die die ganze Zeit bei mir getrunken. Ich dachte bisher: "Wenigstens DAS funktioniert." "Na, aber bei der Kurve stimmt irgendwas nicht", haben sie gesagt. Dann habe ich geweint. Und sie: "Sei froh, dass du überhaupt diese Geburt überlebt hast. In einem anderen Land hättest du das überhaupt nicht überlebt." Ich habe mir dann gedacht, ob ich wirklich so eine Mimose bin und andererseits, dass das ja jetzt wirklich ganz schlimm gewesen sein muss, wenn sie das jetzt so sagt.
Die Geburt war am Dienstag in der Früh. Am Freitag wollte ich einfach nur noch heim. Mich hat dort keiner angeschaut, keiner gewaschen, die haben sich null interessiert - auch psychisch, obwohl ich dort wirklich nur am Weinen war und die Schmerzen auch nicht weniger geworden sind. Sie haben mich dann entlassen. Zuhause haben die Schmerzen nicht aufgehört. Es hat sich angefühlt, als wäre ein Betonpflock bei meinem Steißbein reingehaut worden. Ich konnte nur liegen, war vollkommen verzweifelt.
Ich bin dann zu einem Orthopäden, der hat mich zum MRT (Magnetresonanztomographie) geschickt. Und dann, tatsächlich: mein Kreuzbein ist gebrochen - das ist beim Kristellern passiert. Mein Bauch war danach ja auch komplett blau. Zurück zum Orthopäden, der meinte gleich: "Ich muss Ihnen leider sagen, das ist eine sehr zache Geschichte, das wird Monate dauern, bis das wieder gut ist." Ich bin aus allen Wolken gefallen, habe im Spital angerufen und denen das gesagt. Die haben gesagt: "Das passiert halt, bzw. kann das ja auch daheim passiert sein." Jedenfalls sind sie nicht mehr zuständig, sondern mein Hausarzt. "Aber ich war ja bei Ihnen gebären und nicht in der Arztpraxis", habe ich gesagt.
Ich habe das alles langsam verdaut. Irgendwann habe ich aber gemerkt, meine Nähte fühlen sich nicht richtig an. Wenn ich versucht habe, gegrätscht dazusitzen, hat das so weh getan, als wäre da ein Gummiband gespannt. Und warum? Stellt sich heraus: Weil mir die Assistenzärztin den Scheideneingang ein Stück zugenäht hat. Ich musste also operiert werden, das noch einmal aufschneiden. Es war total verpfuscht, das hat der Chirurg auch so aufgeschrieben: "Nicht nur zu eng, sondern auch schief genäht." Das muss man sich auch einmal geben. Nach so einer Geburt muss ich zwei Monate später da nochmal liegen und mir so reinschneiden lassen. Das war wie eine Retraumatisierung. Ich hatte so schlimme Panikattacken und Angstzustände wie noch nie zuvor. Ich habe in der Zeit einfach nicht realisiert, dass das ein mega-arges Trauma ist. Die Schmerzen sind nicht besser geworden, ich konnte nicht sitzen. Jedes mal aufs Klo gehen: Schmerzen. Ich hatte Angst zu essen, damit ich nicht aufs Klo muss.
Um unsere Tochter hat sich mein Freund gekümmert. Das ging, weil er gerade in der letzten Phase des Studiums war. Zum Glück, das wäre alles sonst nicht möglich gewesen. Gerade durch dieses Nicht-sitzen-können. Ich konnte nur im Liegen stillen, hatte monatelang immer noch starke Schmerzen. Dann wieder die Suche nach der Ursache, von Arzt zu Arzt. Ich habe auch schon an mir gezweifelt. Ich habe dann eine Physiotherapeutin gefunden, die auf den Beckenboden spezialisiert war. Die meinte, das sind Nervenschmerzen. Sie hat herausgefunden, dass bei mir im Beckenboden der Pudendus-Nerv (Schamnerv) beschädigt war, der von Schamlippen, Anus, Damm, alles mögliche versorgt.
Ich war bei dann bei Schmerzspezialisten, einer meinte, der Schmerz ist schon im Schmerzgedächtnis, da muss man mit Antidepressiva arbeiten. Ich bin nur noch in einer Arztschleife gesteckt. 9.000 Euro habe ich insgesamt ausgegeben für Psychotherapie, Physiotherapie, Osteopathie, Shiatsu, ich hätte schon Hexen im Internet auch schon fast etwas gezahlt, vor lauter Verzweiflung. Ich dachte, ich muss jetzt damit leben, habe mir alle möglichen Selbsthilfebücher gekauft. Ich bin schon eine Kämpferin, aber wer will denn das. Mit Säugling zusätzlich noch so starke chronische Schmerzen zu haben. Von Sex will ich gar nicht reden. Das war für mich unvorstellbar, dass das jemals wieder gehen soll. Allein der Gedanke, dass ich da berührt werde ... Da hat mich wirklich meine Physiotherapeutin gerettet. Die hat mir so Mut gemacht, dass wir das gemeinsam mit einem Psychotherapeuten sicher hinkriegen werden.
Ich habe später online eine Dame gefunden, die bietet Geburtsverarbeitungskurse an, dazu gehören traumasensitive Yogaübungen, Meditationen und Gespräche. Und all diese verschiedenen Menschen, die mir geholfen haben, haben es geschafft, mir die Sicherheit zu geben, dass mein Körper das jetzt wieder hinbekommt, dass das wieder gut wird. Das hat über ein Jahr gedauert. Aber auch jetzt noch, wenn ich sehr angespannt bin, zieht sich der Beckenboden gleich zusammen, auch den beschädigten Nerv spüre ich noch. Und auch in meinen Träumen begleitet mich die Erfahrung, gerade das Kristellern. Ich habe meine Schreie noch lange im Traum gehört. Mir wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert.
Ich spüre immer noch eine ganz große Traurigkeit, dass diese ganze Zeit so negativ geprägt ist. Ich wollte immer Mama werden und habe mir alles schön ausgemalt. Ich habe auch Schuldgefühle, dass ich mein Kind irgendwie verunsichert oder geprägt habe, durch meine eigene Verzweiflung und Instabilität während dieser ganzen Phase.
Ich hätte eigentlich so gern noch ein Kind gehabt, konnte mir das aber lange gar nicht mehr vorstellen. Das wird langsam besser. Ich habe verstanden, dass ich oder mein Körper nichts falsch gemacht haben, sondern dass ich einfach mies betreut wurde. Da hätte ich alleine auf einer Alm auch gebären können - mir wurde ja alles, was die moderne Medizin hergibt, verwehrt. Wenn, dann würde ich mich bei einem zweiten Kind aber für einen geplanten Kaiserschnitt entscheiden, das empfiehlt mir auch mein Gynäkologe. Noch eine Geburt auf natürlichem Weg, das kann ich mir nicht vorstellen - auch wegen dem ganzen Narbengewebe.
Mein Vertrauen zu Ärzten ist leider verschwindend gering. Ich bin viel skeptischer geworden. Das ist natürlich schwierig, man ist ja selbst kein Arzt und ist auf sie angewiesen - gerade wenn man ein Kassenpatient ist. Meine Eltern haben schon beim ersten Mal angeboten, dass sie mir die Geburt in einer Privatklinik zahlen würden. Beim nächsten Kind komme ich fix darauf zurück. Das ist aber eine Zumutung. Weil jetzt komme ich aus einer Familie, die mich so unterstützen kann - aber was mache ich, wenn ich zugezogen bin, die Sprache nicht so gut kann? Dass man respektvoll behandelt wird bei einer Geburt, in Zeiten, wo man schon so viel darüber weiß, das kann ja nicht abhängig davon sein, wieviel Kohle ich habe! Das macht mich so wütend.
In den Geburtsvorbereitungskursen darf das nicht so verniedlicht werden, als gäbe es diese ganzen möglichen Interventionen nicht. Das ist eine absolute Frechheit. Ich hätte das gerne ehrlich gewusst, dann hätte ich mir z.B. eine eigene Hebamme organisiert. Man muss als Frau in die Entscheidungen mit einbezogen werden, und über seine Möglichkeiten informiert werden. Frauen sollte einfach klar sein, dass sie auch ein Mitspracherecht haben.
Ich habe mich seither mehrmals ans Spital gewendet, erst wurden meine Mails nicht beantwortet, dann haben sie geschrieben, dass das mit dem Bruch passieren kann, die verpfuschte Naht sei "subjektives Empfinden". Ich war dann bei der Patientenanwaltschaft, dort hieß es dann nach langem Herumtun auch "War halt ein Pech". Um diese Einschätzung nachvollziehen zu können, habe ich dann den Geburtsbericht vom Spital angefordert - da stand das Kristellern gar nicht drinnen. Nur dass ich "über extreme Schmerzen klage".
Ich war dann sogar noch bei einem Anwalt, der hat mir dann aber abgeraten, das weiter zu verfolgen. Mir wurde immer wieder gesagt: "Seien Sie doch froh, dass das Kind gesund ist." Das bin ich natürlich auch - aber was ist denn das für ein Maßstab??
Mein großes Glück ist, dass ich ein fröhliches Gemüt habe und von meinem Umfeld viel Unterstützung bekomme. Wie übersteht das aber jemand, der zu Depressionen neigt, oder bei dem durch so ein Trauma die Bindung zum Kind gestört wird? Mich hat mein Baby total gerettet. Sie zu stillen, das war auch für mich schön.
Über das Thema wird meiner Meinung nach einfach nicht genug geredet, es ist absolut tabu. Wenn man aber bei anderen Müttern nur ein bisschen nachfragt, dann haben wirklich viele solche und ähnliche Geschichten von der Geburt zu erzählen. Dazu möchte ich auch noch eines sagen: Es ist das ist traumatisch, was die Frau als traumatisch erlebt. Das darf man dann nicht abtun. Das entscheiden nicht die anderen für einen, ob das jetzt schlimm war oder nicht. Das hat keiner zu bewerten.
Mir ist ganz wichtig, betroffenen Frauen weiterzugeben: Selbst wenn man so etwas Schreckliches erlebt, wenn man wirklich gute Hilfe bekommt, kann man die Geschichte gut ins Leben integrieren. Das ist jetzt einfach meine Geschichte. Dass ich jemals davon erzählen kann, ohne in Tränen auszubrechen, das hätte ich mir vor einem Jahr noch nicht gedacht. Ja, es ist ein schwerer Start ins Leben mit einem Kind - aber man ist nicht für immer davon gezeichnet.

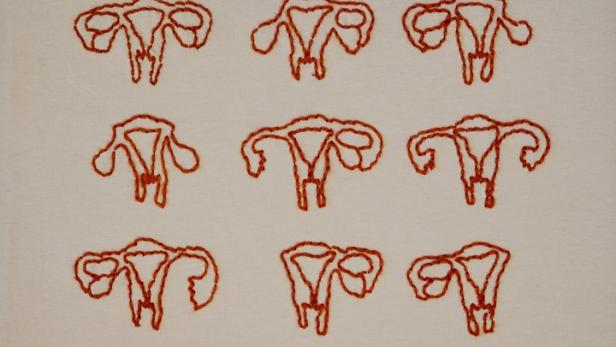

Kommentare