Gender Pain Gap: Wenn Schmerzen von Frauen nicht ernst genommen werden

Uschi Juno war vor dem Eingriff zum Einsetzen der Spirale nicht allzu besorgt. Schließlich bezeichnet sie sich selbst als recht schmerzresistent, benötigte auch bei der Geburt ihres Kindes keine Schmerzmittel. Ihre langjährige Frauenärztin hatte im Vorgespräch gesagt, dass der Eingriff „ein bisschen unangenehm, aber gut auszuhalten“ sei. Ganz so war es dann aber leider nicht. Als „sehr, sehr heftig“ beschreibt Juno den Schmerz, eine 7 oder 8 auf einer Schmerzskala bis 10. Der Kreislauf spielte nicht mit, sie musste sich hinlegen und mit dem Taxi nach Hause fahren. Die starken Schmerzen ließen erst im Laufe des folgenden Tages nach.
Eine Erfahrung, die sie von Anfang an herunterspielte, und auch ihrer Frauenärztin nicht rückmeldete. „Ich wollte kein großes Ding daraus machen“, sagt sie im Gespräch mit dem KURIER. Bis ihr kürzlich ein Artikel auffiel, in dem es um verschiedene Möglichkeiten der Schmerzlinderung beim Einsetzen der Spirale ging. Zwei Dinge fielen ihr besonders auf: Zum einen war sie über diese Optionen von ihrer Ärztin nicht informiert worden. Zum anderen überwältigte sie die Flut an Kommentaren unter dem Artikel, in dem Frauen ihre Erfahrungen schilderten.
Vorbereitung
„Bis dahin dachte ich, dass ich mit meiner Erfahrung die Ausnahme bin. Vielleicht ist die Ausnahme aber das genaue Gegenteil.“ Dabei wäre Junos Wunsch denkbar simpel: „Ich erwarte von einem Arzt eine realistische Vorbereitung auf das, was einen erwartet. Dass man weiß, dass man für zumindest den kommenden Tag Ruhe braucht, die Kinderbetreuung abgibt, dass es gut wäre, eine Begleitung mitzunehmen. So, wie es bei anderen Eingriffen ganz selbstverständlich gemacht wird.“
Sie stellte dann auf Twitter selbst die Frage nach den Erfahrungen anderer bei diesem Eingriff. Die Folge: Hunderte Schilderungen von Frauen, die ganz Ähnliches erlebt hatten. Viele stuften ihre Schmerzen sogar noch höher ein als Juno. Und erschreckend viele hatten das Gefühl, dass ihre Schmerzen in den Praxen nicht wirklich ernst genommen wurden. Das Ergebnis ist keine Überraschung für Alexandra Kautzky-Willer, Österreichs erste Professorin für Gender Medicine. „Aber es ist doch immer wieder erstaunlich“, sagt sie. „Wir wissen, dass Schmerzen bei Frauen im Gesundheitssystem eher unterschätzt werden.“
Halb so schlimm?
Frauen haben stärkere, häufigere und länger andauernde Schmerzen als Männer – dennoch ergaben Studien, dass die Schmerzen von Patientinnen generell niedriger eingestuft wurden als die von Patienten.
Dieses Phänomen nennt sich „Gender Pain Gap“. In der Praxis bedeutet das beispielsweise, dass Patientinnen mit starken Schmerzen eher Psychopharmaka statt Schmerzmittel verordnet bekommen. Bei männlichen Patienten passiert das deutlich seltener.
Der Grund dafür? „Es liegt wohl an Geschlechterstereotypen“, sagt Kautzky-Willer. „Frauen wird zugeschrieben, oft zu übertreiben, sensibler zu sein oder gar hysterisch. Bei Männern ist es umgekehrt, sie gelten eher als stoisch, gehen später zum Arzt als Frauen. Dafür werden ihre Schmerzen dann aber auch besser abgeklärt.“ Oftmals wird auch davon ausgegangen, dass Frauen, als diejenigen, die Kinder gebären, in der Lage sind, größere Schmerzen auszuhalten als Männer, heißt es in einer Studie. Das bestätigt auch Kautzky-Willer: „Frauen haben von der frühen Pubertät an ihr Leben lang viel mehr Schmerzen als Männer. Das hängt auch mit den Sexualhormonen zusammen. Ihre Schmerzen werden eher chronisch, doch sie wurden so sozialisiert, sie zu ertragen.“
Ernste Symptome
Das spiegelt sich dann in den Erfahrungen von Uschi Juno und den vielen Frauen wider, die beschreiben, wie sie ihre Schmerzen einerseits selbst herunterspielten, andererseits aber auch erwartet wurde, dass sie diese aushalten können sollten.
Gefährlich wird das dann, wenn es beispielsweise um die Erkennung von Herzinfarkten geht: „Frauen zeigen hier andere, weniger auffällige Symptome als Männer“, erklärt die Gender-Expertin Kautzky-Willer. „Übelkeit, Erbrechen, Schwächegefühl – der Ernst der Lage wird dann oft nicht erkannt, die Untersuchungen dauern länger und verzögern sich. Daraus ergibt sich für Herzinfarktpatientinnen dann die sehr reale Gefahr einer höheren Sterblichkeit.“
Zeit bis zur Diagnose
Auch bei der Endometriose, die allein in Österreich bis zu 300.000 Frauen betrifft, haben die Patientinnen oft einen sehr langen Leidensweg hinter sich. Um die zehn Jahre dauert es vom ersten Auftreten der Symptome im Schnitt bis zur korrekten Diagnose.
„Es braucht viel mehr Forschung“, sagt die Medizinerin über das komplexe Thema. Generell sollten Ärztinnen und Ärzte aber darauf achten, Klischees zu hinterfragen, den Schilderungen von Patientinnen objektiv zu begegnen und sich ausreichend Zeit für sie und die Abklärung des Problems zu nehmen. Frauen, die sich in der Arztpraxis nicht ernst genommen oder nicht gut betreut fühlen, rät sie nachzufragen, eine Zweitmeinung einzuholen oder den Arzt zu wechseln.
„Seien Sie hartnäckig, hinterfragen Sie, seien Sie lästig!“ Schmerzen sind nicht dazu da, um sie aushalten zu müssen.
Gender Health Gap
In Medizin und Forschung werden Männer als die Norm gesehen. So beispielsweise auch bei Medikamentenstudien. Eine Folge: Frauen leiden häufiger unter unerwünschten Nebenwirkungen
Klischees
Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass Worte wie „sensibel“, „simulieren“, „beschweren“ und „hysterisch“ eher in Beschreibungen von Schmerzberichten von Patientinnen angewandt werden
Women of Colour
Nicht-weiße Frauen sind vom Gender Pain Gap noch stärker betroffen als weiße. Sie erhielten eine „qualitativ schlechtere Behandlung mit unzureichenden Ergebnissen, erhöhter Krankheitswahrscheinlichkeit und Sterblichkeit,“ heißt es in einer britischen Studie aus dem Jahr 2020
Psyche
Der Gender Pain Gap schadet auch Männern. Bei ihnen werden bei gleichen Symptomen eher körperliche Ursachen für psychische Beschwerden vermutet. Das führt dazu, dass Depressionen bei ihnen häufig nicht diagnostiziert und behandelt werden
Petition von Uschi Juno
Bessere Information über mögliche Schmerzen und Komplikationen beim Einsetzen und Entfernen der Spirale
https://mein.aufstehn.at/petitions/gebt-uns-bessere-schmerzlinderung-fur-das-einsetzen-und-entfernen-der-spirale


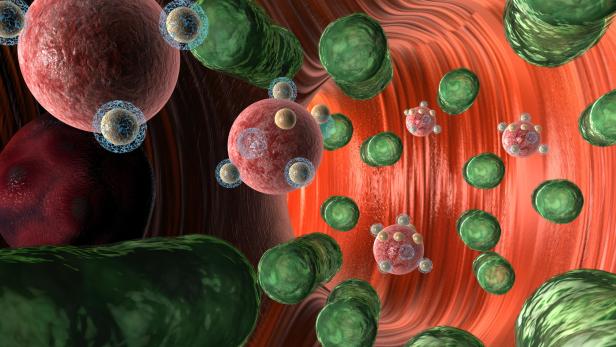
Kommentare