Die Corona-Krise kostet Österreich mehr als 13 Milliarden Euro

Durch Kurzarbeit behalten mehr Leute ihren Arbeitsplatz. Dadurch könnte der Konsum stabil bleiben und den Abschwung mildern.
Durch die Ausbreitung des Coronavirus in Europa und die dadurch entstandenen Ausnahmezustände in den einzelnen Ländern ist eine Rezession für Österreich unausweichlich geworden. Zu diesem Ergebnis kommt Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung und Leiter des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung.
Großer Rückgang
„Wenn sich das Ausmaß nicht noch verschlimmert, wird es zu einer BIP-Schrumpfung von 2,5 Prozent kommen“, sagt Helmenstein. Das wäre in Summe ein Rückgang in Höhe von 13,7 Milliarden Euro. Damit wäre die BIP-Schrumpfung allerdings geringer als beim Ausbruch der Wirtschaftskrise 2008/’09, denn damals lag sie bei 3,8 Prozent.

Ökonom Christian Helmenstein geht bei seiner Berechnung in Europa von einem ähnlichem Ablauf der Krankheit wie in China aus.
Ein auffallendes Phänomen: „2008/’09 ging es rascher abwärts als 1929 (Ausbruch der Weltwirtschaftskrise, Anm.) und jetzt 2020 geht es rascher abwärts als 2008/’09“, sagt Helmenstein. Das sei durch die heftigen Interventionen gegen die Corona-Pandemie zu erklären, wie die Schließung von touristischen Betrieben, die Absage von Sport- und Kulturevents und die Reduktion der Handelsaktivitäten.
Zwei Schocks
Helmenstein erkennt zwei simultane Schocks, einen auf der Angebots- und einen auf der Nachfrageseite. „Der Angebotsschock ist eine Folge der Betriebsschließungen wegen der rechtlichen Interventionen.“ Es könne deshalb sogar zu Unterbrechungen von Lieferketten kommen, etwa durch die Absenz von Pflegerinnen oder Erntehelfern.
Ein „positiver“ Angebotsschock sei der enorme Verfall des Ölpreises. „Dieser wirkt sich inflationsdämpfend aus und stärkt die Kaufkraft.“ Für betroffene Unternehmen aus der Ölindustrie sei das natürlich nicht positiv.
"Exzellent"
Nachfrageschocks würden folgen, wenn es mehr Arbeitslose gebe und die Kaufkraft zurückgehe. „Exzellent“ sei in diesem Zusammenhang die Corona-Kurzarbeit. Viele würden dadurch ihre Jobs behalten. Dadurch könnte der Konsum stabil bleiben und die Krise mildern.
Ein Umstand, der ihm Sorgen macht: „Die Kursrückgänge in den USA sind noch deutlich geringer als in Europa.“ Wenn in den USA die Kurse weiter sinken, könne das die europäischen Börsen noch mehr unter Druck setzen. „Da hängt noch ein Damoklesschwert über uns“, sagt Helmenstein. Abgesehen davon sei er optimistisch, dass bei den Kursen in Europa eine Bodenbildung erreicht wurde.
Rasche Investitionen
Wenn es zu administrativen Erleichterungen und einer baldigen Senkung der Körperschaftssteuer käme, könnten die Investitionen der Unternehmen im dritten Quartal wieder anziehen und bis zum ersten Quartal 2021 wieder das Vorkrisenziel erreicht haben. All diesen Einschätzungen liegt die Annahme zugrunde, dass der Ausnahmezustand zwei Monate anhält und die Corona-Krise in Europa im Wesentlichen dem zeitlichen Verlauf wie in China folgt.
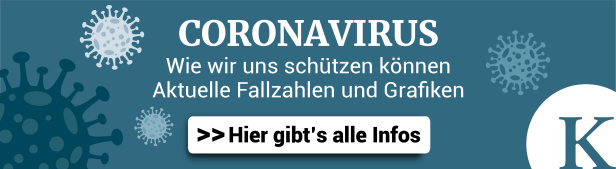




Kommentare