Babyelefant bis Visier-Verbot: Die Anschober-Verordnung im Check

Gesundheitsminister Rudolf Anschober wollte diesmal alles richtig machen.
Die Empörung war groß. Nur etwa vier Stunden, bevor sie eigentlich in Kraft treten hätte sollen, wurde die neue Corona-Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag publik gemacht. Immerhin: Weil die Verordnung für viele Einschnitte bedeute und sie ein Recht hätten, sich entsprechend vorzubereiten, hatte der Minister ein Einsehen und verschob das Inkrafttreten auf Sonntag.
Warum aber dauerte es von der Pressekonferenz, bei der die Maßnahmen präsentiert wurden, bis zur Veröffentlichung einer rechtlichen Grundlage so lange? Warum so viele Verzögerungen?
Der Grund dafür dürfte in der Abstimmung zwischen den türkisen und grünen Kabinetten und dem Bundeskanzleramt liegen. Die Abstimmung sei manchmal zeitintensiver, als man das eingeplant hat, erklärte Anschober am Freitag. Man habe schlussendlich "ein hochprofessionelles Paket" vorgelegt, mit dem Hauptziel, eine Kontaktminimierung und somit weniger Ansteckungen herbeizuführen. Die Verordnung sei punktgenau und werde sich positiv niederschlagen, war sich der Minister sicher. "Wichtig ist, dass die Maßnahmen wirken, nicht wann sie publiziert werden."
Doch werden sie das tun? Der KURIER hat mit Experten gesprochen, die die neue Verordnung aus virologischer und juristischer Sicht analysieren.
"Vernünftig"
Zunächst zur vordergründigen Frage: Ist die Verordnung geeignet, um eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie zu verhindern? Von virologischer Seite kommt grundsätzlich grünes Licht. Sie sei ein "sinnvolles Signal", sagt Virologe Christoph Steininger von der MedUni Wien. Vor allem das anvisierte Verbot von Gesichtsschilden und Kinnvisieren sei aufgrund erwiesenermaßen mangelnder Schutzwirkung „längst überfällig“ gewesen. Effektiv wären Visiere nur, "wenn sie rings um den ganzen Kopf herum dicht abschließen würden, und das ist nicht vorstellbar". Auch, dass sich die Bevölkerung nun wieder verpflichtend am Babyelefanten orientieren muss, sei vernünftig.
Da mit dem Alkoholpegel häufig das Infektionsrisiko steige, seien auch die Einschränkungen beim Konsum prinzipiell nachvollziehbar. "Hier hat man wohl Lehren aus dem bisherigen Verlauf der Pandemie gezogen, Stichwort Après-Ski."
Die Personen-Begrenzung in Innenräumen beruhe in ihrer exakten Ausführung zwar nicht auf wissenschaftlichen Studien, "allerdings wird damit ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass sich nicht zu viele Menschen in einem Raum versammeln sollen", sagt Steininger.

Virologe Steininger hält die Verordnung für nachvollziehbar.
"Zulässig"
Abseits der virologischen Wirkmächtigkeit der neuen Verordnung steht die Frage nach ihrer rechtlichen Gültigkeit im Raum. Nicht zuletzt, weil es bei Verordnungen und Erlässen aus dem Gesundheitsministerium in der Vergangenheit bereits einige juristische Probleme gab und sogar der Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingreifen musste.
Die neue Verordnung sei "im Großen und Ganzen verfassungsrechtlich zulässig", sagt Dominik Prankl. Er ist jener Jurist, der Beschwerde gegen die Corona-Ausgangsbeschränkungen im März einlegte und vom VfGH recht bekam. So habe die Abstandsvorschrift, also der berühmte "Babyelefant", mit dem novellierten Covid-19-Maßnahmengesetz eine Rechtsgrundlage bekommen. Und auch das Verbot von Alkoholkonsum im Umfeld von Lokalen sowie jenes der Gesichtsschilde sei gesetzlich gedeckt.

Für Jurist Dominik Prankl ist die Sechs-Personen-Regel unsauber.
Bedenken hat Prankl lediglich bei der Sechs-Personen-Regel für private Veranstaltungen. Denn die neue Verordnung nimmt keine Rücksicht auf die Größe der Räumlichkeiten. "Hier sehe ich Ansatzpunkte für den Verfassungsgerichtshof", sagt er. Auch die Relation – sechs Personen im Privatbereich, 1.000 bei professionellen Veranstaltungen – sei schwer nachvollziehbar. Er mutmaßt: Bei Ersterem gehe es um den Schutz der Gesundheit, bei Zweiterem um den Schutz der Wirtschaft. Und: Da es ab sechs bzw. zwölf Personen bereits ein Präventionskonzept brauche, liege der Schluss nahe, dass "man mit diesen bürokratischen Kautelen kleinen Veranstaltern die Lust am Veranstalten nehmen möchte".
Ein Punkt hat den Juristen besonders amüsiert: In der Verordnung wird festgehalten, dass der Mindestabstand nicht "unter Wasser" gilt. "Das ist tatsächlich eine kuriose Regelung, wenn auch rechtlich völlig unbedenklich", erklärt Dominik Prankl. Dieser Punkt sei eigentlich logisch, da es unter Wasser kein Übertragungsrisiko gebe. Und sage deshalb "einiges über die österreichische Bürokratie aus".

Die Verordnung
Der Mund-Nasen-Schutz muss nun eng anliegen. Damit wird klargestellt, dass Gesichtsschilde und Kinnvisiere nicht als MNS gelten. Das Aus für Gesichtsvisiere wurde in einer weiteren Verordnung geregelt und tritt am 7. November in Kraft.
Das sagt der Jurist
„Das Verbot von Gesichtsschilden ist zweifelsfrei vom Gesetz gedeckt“, erklärt Dominik Prankl. „Da es auch wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass diese Schilde nichts bringen, kann man auch nicht sagen, dass es unsachlich sei.“
Das sagt der Virologe
„Längst überfällig“, sagt Christoph Steininger. Schon im Sommer hätten Studien gezeigt, dass Visiere keinen ausreichenden Schutz bieten. „Sie vermitteln ein trügerisches Sicherheitsgefühl. Tröpfchen und Aerosole werden weder vom Träger noch vom Gegenüber abgehalten.“

Die Verordnung
Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien muss man gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einen Ein-Meter-Abstand einhalten. In geschlossenen, öffentlich zugänglichen Räumen gilt zudem die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Das sagt der Jurist
„Die Regelung findet nun Deckung im Gesetz, weil Maßnahmen nicht mehr auf bestimmte Orte beschränkt werden müssen – wie im alten Recht vorgesehen.“ Laut Covid-Maßnahmengesetz kann das Betreten öffentlicher Orte in der Gesamtheit geregelt werden.
Das sagt der Virologe
„Der Mindestabstand ist eine Faustregel, die nicht 100-prozentig schützt, aber anleitet, auf Abstand zu gehen.“ Aus Grippe-Studien wisse man, dass Tröpfchen beim Husten etwa so weit fliegen können. „Bei fehlender Luftzirkulation ist man drinnen nur mit Maske gut geschützt.“

Die Verordnung
Nach Sperrstunde darf kein Alkohol im Umkreis von 50 Metern um ein Lokal konsumiert werden. Das gilt auch für Tankstellenshops und Imbissstände. In Tirol, Vorarlberg, Salzburg ist derzeit um 22 Uhr Sperrstunde, in den restlichen Bundesländern um 1 Uhr.
Das sagt der Jurist
„Auch diese Regelung ist gedeckt“, sagt Prankl. Die Absicht dahinter sei offenbar, das Zusammenströmen von Menschen nach der Sperrstunde zu vermeiden – bei Alkoholisierung besteht bekanntlich die Gefahr, dass der Mindestabstand unterschritten wird.
Das sagt der Virologe
„Feuchtfröhliches Feiern ist in Kombination mit Menschenansammlungen problematisch.“ Das Ansteckungsrisiko steige, weil die Abstandsregel eher missachtet wird „und nicht nur Hemmungen, sondern oft auch die Vernunft mit steigendem Alkoholpegel fällt“.

Die Verordnung
Für Veranstaltungen wurden die Teilnehmerzahlen deutlich verringert. Ohne zugewiesene Sitzplätze sind in geschlossenen Räumen sechs Erwachsene plus höchstens sechs Minderjährige erlaubt. Im Freien sind es zwölf Personen plus höchstens sechs Kinder.
Das sagt der Jurist
„Hier sehe ich Ansatzpunkte für den Verfassungsgerichtshof. Ist es sachlich gerechtfertigt, starre Grenzen für Veranstaltungen vorzusehen, oder müssten nicht die räumlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden?“ fragt der Jurist.
Das sagt der Virologe
„Es macht für eine Infektion keinen Unterschied, ob fünf, sechs oder sieben Menschen versammelt sind. Je weniger, desto sicherer.“ Die Regelung schaffe aber eine im Alltag lebbare Handlungsrichtlinie, die es leichter mache, das Risiko zu verringern.
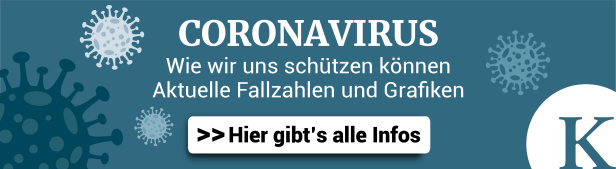




Kommentare