Wenig Coronavirus-Infizierte: Ist der hohe Aufwand gerechtfertigt?

„Aus medizinischer Sicht ist für mich die Aussage klar: Es gibt in der Bevölkerung bisher nicht erkannte, infizierte Menschen, die das Virus weitergeben, ohne das zu wissen. Deshalb sind Maskenpflicht und alle anderen Maßnahmen sinnvoll.“ Das sagt Virologe Christoph Steininger von der MedUni Wien / AKH Wien zur SORA-Studie (siehe Teaser unten). Sechs Personen hatten einen positiven PCR-Test. Drei wussten bereits beim Erstanruf der Studienorganisatoren von ihrer Infektion. Bei drei weiteren Personen wurde sie erst im Rahmen der Studie erkannt.
Steininger betont, dass es in der Stichprobe auch unerkannte Infizierte geben könnte: Zu Beginn einer Infektion kann der PCR-Test negativ sein, obwohl sich das Virus im Körper bereits vermehrt. Möglich ist auch, dass gegen Erkrankungsende noch Virus-Erbgut nachgewiesen wird, die Person aber längst nicht mehr ansteckend ist.
„Und diese Studie sagt auch nichts darüber aus, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der bereits eine Infektion durchgemacht hat“, betont Steininger.
Insgesamt hält er das Ergebnis für plausibel: „Wären zehn Prozent der Getesteten infiziert, hätten wir das auch schon in den Krankenhäusern gemerkt.“ Und die relativ niedrige Zahl der Infizierten spreche dafür, „dass unsere Strategie die richtige war“.
Auch für den IHS-Gesundheitsökonomen Thomas Czypionka zeigt das Ergebnis, „dass die Maßnahmen gewirkt haben und sich die Menschen daran halten – sonst wäre die Dunkelziffer der unerkannten Fälle höher.“ Auch er verweist darauf, dass nur Antikörpertests Aufschluss über den Anteil der Personen geben können, die bereits infiziert waren. Die Untersuchung sei mit einer relativ kleinen Stichprobe zu einem Zeitpunkt durchgeführt worden, zu dem sehr wenige Menschen das Virus aktiv weitergaben. Und es sei auch die Wahrscheinlichkeit falsch positiver Testergebnisse hoch. „Das alles ist keine Kritik, so waren die Voraussetzungen. Aber es bedeutet, dass man in der Schwankungsbreite der Infizierten zwischen 10.200 und 67.400 eher einen niedrigen Wert annehmen muss. Von der Herdenimmunität sind wir sicher weit entfernt.“
Laut der Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien wäre die Dunkelziffer ohne die Maßnahmen „wahrscheinlich höher, allerdings fehlt uns der Vergleich zu vorher“.
Corona-Dunkelziffer: vermutlich 28.500 Personen infiziert
Anstieg erwartet
„Im Moment sind wir auf der sicheren Seite“, sagt der Simulationsforscher Niki Popper von der TU-Wien. Er rechne zwar mit einem leichten Anstieg der Infektionszahlen in den kommenden Wochen, „aber nicht mit einem unkontrollierten Peak, deshalb sind die Lockerungen ja gestaffelt“. Die SORA-Daten und die Dunkelziffer-Simulationen würden auch darauf hinweisen, dass der tatsächliche Erkrankungs-Peak schon viel früher gewesen sei als der Peak bei den Testergebnissen.
Auf die in sozialen Medien oft gestellte Frage, ob die Maßnahmen samt den wirtschaftlichen Folgewirkungen gerechtfertigt waren, wenn nur 0,33 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus infiziert sind, sagt Popper: „Die Frage ist, welche Größe man im Auge hat. Wir haben es mit sehr hohem Aufwand und sehr hohen Entbehrungen geschafft, die Kapazität der Intensivbetten nicht zu überschreiten. Trotz aller Maßnahmen waren wir aber bei rund 300 mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten. Wir haben für diese Patienten ganz grob aber nur rund 1000 Betten.“ Und die können schnell voll sein: „Wenn täglich 50 Patienten neu auf die Intensivstationen kommen und dort im Schnitt drei Wochen liegen, sind diese Stationen nach drei Wochen voll. Und das wäre ein konstanter Verlauf. Wenn er nicht konstant bleibt, ist das Problem viel größer.“
Lockert man die Maßnahmen zu rasch, könne man sehr schnell doppelt so viele Patienten wie derzeit in den Spitälern haben. Die Folgen sehe man in Schweden: „Dort setzt man auf eine raschere Durchimmunisierung, aber die Todeszahlen sind deutlich höher.“ Das Aufmachen der Maturaklassen sei eine sichere Sache: „Das sind ja nur sehr wenige Menschen, ebenso die Pflichtschulabschlüsse.“
In Zukunft werde entscheidend sein, Infizierte rasch durch Tests „aus der Reproduktionskette“ herauszuholen, um die Virusausbreitung zu bremsen. Popper betont, dass die Maßnahmen nur der Rahmen sind, es aber auf jeden einzelnen ankomme: „Je mehr wir uns dort einschränken, wo es nicht wehtut, umso besser wird der Effekt sein. Aber wenn wir in der U-Bahn nicht mehr genug Abstand halten, keine Masken tragen, uns anhusten, dann stimmen auch die Modelle nicht mehr. Die Strategie von Hammer und Tanz - zuerst strenge Maßnahmen, dann Lockerung - funktioniert nur, wenn jetzt alle solidarisch sind.“
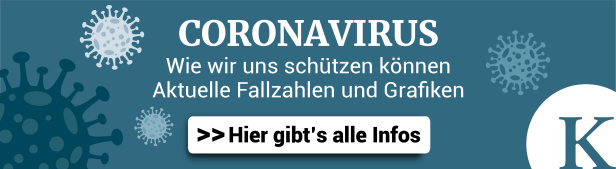



Kommentare