Spritze oder Spray: Wie wirken Covid-Impfstoffe am besten?
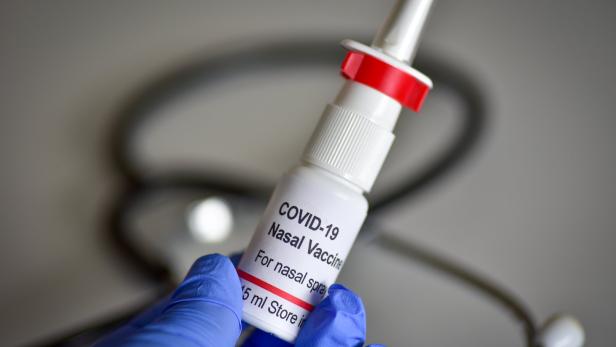
Nasale Covid-Impfstoffe (im Bild: ein Testprodukt) werden direkt über die Atemwege verabreicht.
Wer sich in der Vergangenheit gegen Corona oder einen anderen Krankheitserreger impfen hat lassen, kennt es: Die Injektionskanüle wird senkrecht bis in den Muskel eingestochen. Dann wird die Lösung injiziert – sie verteilt sich im Muskel. Begleitet von leichtem bis mittelstarkem Ziehen.
Neben dieser intramuskulären Verabreichungsform stehen auch andere Methoden zur Verfügung: So können Impfungen, aber auch andere Arzneien, generell in die Nase oder ins Unterhautfettgewebe (subkutan) appliziert werden.
Neue Nasen-Impfstoffe werden nach wie vor intensiv erprobt
Schon in der Frühphase der Corona-Impfstoffentwicklung begann man das Potenzial nasaler Impfstoffe auszuloten. Weltweit sind inzwischen vier Covid-19-Impf-Nasensprays von Arzneimittelbehörden in China, Indien und Russland zugelassen worden.
Nun ist eine Phase-I-Studie – bis zur offiziellen Zulassung müssen Arzneien in der Regel drei klinische Studienphasen durchlaufen – mit einem neuen Nasen-Impfstoff gestartet. In vorangegangen Tierstudien erzielten die US-Gesundheitsinstitute (NHI) gute Ergebnisse hinsichtlich Verträglichkeit und Wirksamkeit.
Die Präparate bieten zahlreiche Vorteile, weiß Christina Nicolodi, international tätige Vakzinologin und Expertin für nasale Impfstoffe.
"Die meisten Keime, egal ob virale oder bakterielle, kommen über den oberen respiratorischen Trakt, also Nase oder Mund, in den Körper", erklärt sie. "Dort besitzen wir eine Schleimhaut, die sogenannte Mukosa." Ein Charakteristikum der Mukosa sei, "dass sie eine bestimmte Klasse von Antikörpern produziert, das Immunglobulin A". Immunglobulin A stellt einen wesentlichen Teil der im menschlichen Körper produzierten Antikörper dar. "Insbesondere bei Infektionen, dockt dieser Antikörper als Erstes an das Virus an und verhindert, dass es sich an die Schleimhautzellen setzen und sie infizieren kann."
"Natürlichen Weg der Infektion spiegeln"
Aus diesem Wissen wurde vor Jahrzehnten die Idee geboren, "den natürlichen Weg der Infektion mit einem Impfstoff zu spiegeln und diese Route zur Immunisierung zu nutzen". Neben dem Aufbau einer immunologischen Barriere kann so auch die weitere Übertragung der Viren gestoppt werden. Aktuelle Corona-Impfstoffe weisen hier Defizite auf.
Für die Grippe (Influenza) wird in Österreich bereits seit geraumer Zeit ein Nasen-Impfstoff angeboten – allerdings nur für Kinder. In den USA werden auch Erwachsene damit geimpft.
Weniger Nebenwirkungen, Option der Selbstadministration
Ein weiterer Vorteil: "Man sieht viel weniger Nebenwirkungen." Da es keine Einstichstelle gibt, bleiben Schwellunge dort aus. Auch andere Nebenwirkungen wie Fieber oder Abgeschlagenheit treten seltener auf. Gerade in Pandemien, wo Zeit kostbar ist und die breite Verabreichung von Impfstoffen schnell passieren muss, öffnen Nasen-Impfstoffe die Möglichkeit der Selbstadministration: "Es gibt schon Nasensprays, die so konzipiert sind, dass eine Überdosierung nicht möglich ist." Damit könnten Apotheker, Pflegepersonen oder auch Laien die Impfung durchführen.
Allerdings: Für Nasen-Impfungen eignen sich nur Lebendimpfstoffe. Inaktivierte Impfstoffe (Totimpfstoffe) oder mRNA-Vakzine sind ungeeignet. Lebendimpfstoffe, die eine geringe Menge abgeschwächter Krankheitserreger enthalten, sind wiederum schwieriger zu lagern.
Die angeregte Immunantwort sei jedenfalls potent, sagt Nicolodi, sie seit 20 Jahren auf dem Gebiet forscht: "Es werden nicht nur lokale, sondern auch systemische Antikörper aktiviert." In Summe seien sie von der Wirksamkeit her aber nicht mit Impfstoffen, die in den Muskel injiziert werden, vergleichbar.
In den vergangenen Wochen machte SARS-CoV-2 in Österreich wieder verstärkt die Runde. Auch für den bevorstehenden Herbst wird erwartet, dass das Virus erneut grassieren könnte. Damit rücken die gegen das Virus verfügbaren Impfstoffe wieder ins Interesse der Menschen.
Zum bestmöglichen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen empfiehlt das Nationale Impfgremium allen Personen ab 12 Jahren eine Impfung mit neuen, an die zirkulierende JN.1-Variante angepassten Impfstoffen. Vor allem Personen ab 60 Jahren, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf aufweisen sowie medizinischem Gesundheitspersonal wird die Impfung besonders empfohlen. Idealerweise sollte sie im Spätsommer oder Herbst verabreicht werden.
Immer wieder – auch hinsichtlich Covid – wird die sogenannte subkutane Verabreichung von Impfstoffen ins Unterhautfettgewebe als Methode diskutiert, die der Muskel-Injektion überlegen sein könnte. "Ich glaube, dass sie durchaus Vorteile bringen könnte", sagt Nicolodi. Aus früheren Forschungen mit anderen, therapeutischen (nicht prophylaktischen) Impfstoffen wisse man etwa, dass sowohl Nebenwirkungsprofil (Schmerzen an der Einstichstelle sind zum Beispiel geringer) als auch Immunantwort gut seien. Eine mögliche Erklärung: "Im Muskel ist die Dichte an Immunzellen nicht so hoch wie unter der Haut. Die Immunantwort kommt also schneller zustande." Wie bei nasalen Impfstoffen sei auch bei subkutanen eine Selbstadministration in Oberschenkel oder Bauchfalte "denkbar".
Kombinationsschema bei Covid-Impfungen
Weil SARS-CoV-2 gekommen ist, um zu bleiben, bleiben Impfstoffe bzw. Impfstrategien, die die Übertragung der Viren stoppen, weiter relevant. Erst am Dienstag schlug die Weltgesundheitsorganisation (WHO) außerdem wegen aktuell "miserabler" Corona-Impfraten Alarm. Die Impfraten für ältere Personen und Gesundheitspersonal seien besorgniserregend zurückgegangen, erklärte WHO-Expertin Maria Van Kerkhove in Genf. "Wir brauchen hier dringend eine Trendwende."
Von einer Arbeitsgruppe vom Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der MedUni Wien wird für die Zukunft ein spezielles Impfschema angedacht. Demnach, so schreiben die Fachleute im Journal Vaccines, könnte eine Erstimpfung per Injektion unter die Haut im Zusammenspiel mit einer Booster-Impfung über die Nase besonders effektiv sein. Bei Labormäusen konnte eine gute Immunreaktion sowohl im Blut als auch in den Schleimhäuten dokumentiert werden.
Dem Vorschlag, ein Kombinationsschema aus nasaler und subkutaner Impfung zu anzubieten, kann Nicolodi viel abgewinnen. Sie sieht auch im umgekehrten Vorgehen Potenzial: "Wenn man zuerst die lokale Immunantwort aktiviert und danach das systemische Immunsystem boostet, ist das eine sehr gute Kombination."

Kommentare