Hörbeeinträchtigungen bei Kindern: Was Eltern darüber wissen müssen

Für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung ist das bewusste sprachliche Miteinander in der Familie ganz wichtig.
„Horch, hörst du das auch?“ Reagieren Kinder nicht auf Sprache und Geräusche, ist die Verunsicherung der meisten Eltern enorm. Was ist noch „normal“, was ein Anzeichen einer Hörbeeinträchtigung? „Ein Säugling, der nicht hört, beginnt nicht automatisch zu sprechen“, so die diplomierte Audiopädagogin Ulrike Rülicke.
Sie hat mit der Musik- und Bewegungspädagogin Ulrike Stelzhammer-Reichhardt sowie mit Sandra Holzschuh, „Mutter und Wegbegleiterin“ eines hörbeeinträchtigen Sohnes, ein Buch für Familien mit hörbeeinträchtigen Kindern verfasst. Darin zeigen die Autorinnen auf, wie Eltern ihr Kind „ins Hören und Sprechen begleiten“ und damit seine Sprachentwicklung unterstützen können. Diese alltagstauglichen Tipps können auch für Eltern hörender Kinder hilfreich sein.
KURIER: Wie häufig sind Hörbeeinträchtigungen?
Ulrike Rülicke: Bei 1.000 Neugeborenen sind statistisch gesehen ein bis zwei Kinder hörbeeinträchtigt. Ein großer Teil davon fällt bereits in der Woche nach der Geburt beim Neugeborenen-Hörscreening auf. Dieser Test misst die Schallaussendungen des Innenohres auf akustische Reize. Aber nicht alle Hörbeeinträchtigungen werden zu 100 Prozent damit erfasst, manchmal erfolgt die Diagnose erst später. Der Weg bis dahin kann mühsam und schwierig sein.

Audiopädagogin Ulrike Rülicke: "Kinder ins Hören und Sprechen begleiten."
Warum?
Weil das Umfeld oft beschwichtigt, wenn Kinder nicht mit dem Sprechen beginnen oder auf Geräusche nicht reagieren. „Das kommt schon noch“, heißt es dann oft. Aber Eltern kennen ihre Kinder einfach am besten, sollten sich bei einem Verdacht nicht verunsichern lassen und frühzeitig ihren Kinderarzt bzw. dann auch einen HNO-Arzt aufsuchen. Liegt tatsächlich eine Hörbeeinträchtigung vor, ermöglicht erst eine Versorgung mit Hörgeräten oder Implantaten – je nach Grad der Hörbeeinträchtigung – die Entwicklung einer Lautsprache. Damit kann man das Hören „aufwecken“ und für das Kind zu einem vollwertigen Sinn machen.
Das funktioniert aber umso besser, je früher es passiert. Erfolgt die Diagnose etwa erst im Laufe des zweiten Lebensjahres oder später, fehlen dem Gehirn viele Höreindrücke, die für die Sprachentwicklung wichtig sind und erst nach der technischen Versorgung möglich werden. Studien zeigen aber, dass hörbeeinträchtigte Kinder, die bis zum vierten Lebensjahr erfasst werden, dennoch gute Fortschritte machen.
Gibt es eindeutige Hinweise für eine Hörstörung?
Mehr als 90 Prozent der Eltern hörbeeinträchtigter Kinder sind hörend und haben daher keine Erfahrung mit einer kindlichen Hörbeeinträchtigung. Der wichtigste Rat ist: Im Alltag aufmerksam sein und in verschiedenen Situationen, bei denen es etwas zu hören gibt, bewusst hinsehen. Wobei eine Reaktion auf Geräusche nicht bedeuten muss, dass das Kind auch Sprache verstehen kann.
Fällt ein Metalldeckel auf den Fliesenboden, kann es durchaus sein, dass auch ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung zusammenzuckt, weil das ein sehr lautes Schallereignis ist. Die gesprochene Sprache ist aber deutlich leiser. Ein Kind kann Sprachinformationen zum Beispiel auch nur lückenhaft aufnehmen, weil es etwa hohe Töne nicht wahrnimmt. Fragen Vater oder Mutter beim Frühstück, „Willst du heute ein Wurstbrot essen?“, kann es sein, dass es nur auf Brot reagiert und falsch antwortet, weil es „Wurst“ nicht wahrgenommen hat. Ändert sich das auch bei mehrmaligem Wiederholen des Wortes nicht, könnte das ein Warnzeichen sein.
Hörgerät oder Implantat: Wann benötigt ein Kind was?
Ist noch ausreichend Hörvermögen für das Verstehen von Sprache mit Hörgeräten vorhanden, reichen diese aus. Es ist daher sinnvoll, Hörgeräte zwei, drei Monate lang zu testen. Reicht das Hörvermögen nicht aus bzw. wurde ein Kind taub geboren, kann ein Cochlea-Implantat (CI) die funktionsuntüchtigen Haarzellen in der Hörschnecke (Cochlea) im Innenohr ersetzen. Der Natürlich Hörgerichtete Ansatz, den meine Kolleginnen und ich vertreten, ermöglicht Kindern mit Implantaten oder Hörgeräten auf natürlichem Weg Hören und Sprache zu erwerben. Das zentrales Element ist dabei, die Kompetenz der Eltern mit Praxisbeispielen zu stärken.
Wie können Eltern generell den Spracherwerb fördern?
Wir alle sollten dem Hören, Sprechen und Singen wieder mehr Aufmerksamkeit widmen. In vielen Familien wird zu wenig kommuniziert, immer mehr Kinder fallen bereits im Kindergarten durch Sprachentwicklungsverzögerungen auf. Das intuitive Wissen um gute Kommunikation scheint vielfach verloren gegangen, etwa das regelmäßige Wiederholen von Kinderreimen und Kinderliedern, das den Spracherwerb auch unterstützt. Für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung ist das bewusste sprachliche Miteinander besonders wichtig, aber für alle anderen auch.
Buchtipp
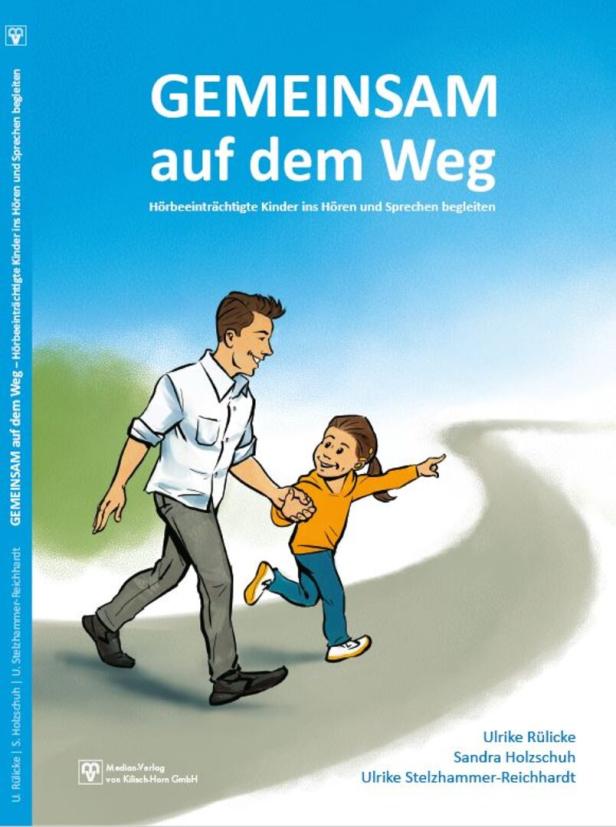
„Gemeinsam auf dem Weg“
Das Buch (192 Seiten, 25 Euro) richtet sich an alle, die Kinder mit Hörbeeinträchtigungen „auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben unterstützten möchten“.
Bestellung
Direkt über www.median-verlag.de oder per E-Mail: aufwiederhoeren@stelzhammer.at
Kommentare