"Schwerwiegendes“ Plagiatsfragment: Justizministerin weist Vorwürfe weiter zurück
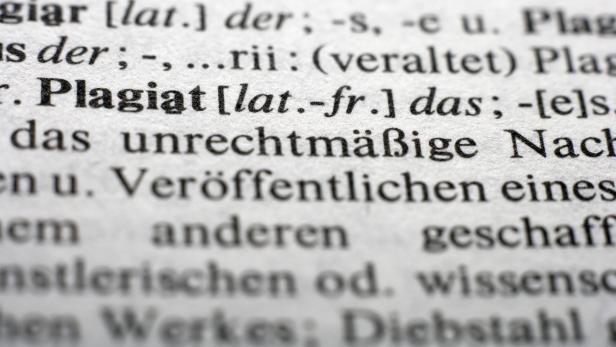
Wissenschaft. Erst das Buch der nunmehrigen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, dann die Diplomarbeit von Österreichs Frauenministerin Susanne Raab und jetzt die Dissertation von Justizministerin Alma Zadić: Manch einer kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Plagiatsgutachter Stefan Weber sich seit dem Rücktritt der von Christine Aschbacher (sie trat im Jänner 2021 nach von Weber erhobenen Plagiatsvorwürfen als Arbeitsministerin zurück) an Politikerinnen abarbeitet. Hat er eine Agenda?
"Nein“, sagt Weber auf KURIER-Nachfrage.
KURIER: Erst Annalena Baerbock, dann Susanne Raab und jetzt Alma Zadić. Manch einer kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie sich seit dem Rücktritt von Christine Aschbacher an wissenschaftlichen Arbeiten von Politikerinnen abarbeiten. Verfolgen Sie eine Agenda oder was ist Ihre Motivation?
Stefan Weber: Werfen Sie bitte einen Blick auf meinen Wikipedia-Eintrag. Da ist auch eine Liste aller "Promis“, die ich bislang des Plagiierens oder des sonstigen Fehlverhaltens wie Titelmissbrauch überführt habe. Von 15 Personen von Johannes Hahn 2007 bis Armin Laschet 2021 sind es 11 Männer und 4 Frauen. Nun kamen zwei Frauen dazu, Frau Raab und Frau Zadić. Es waren Politiker der SPÖ, der ÖVP und der Grünen dabei sowie der Historikerbericht der FPÖ. Der Zusammenhang von Geschlecht oder Parteizugehörigkeit und wissenschaftlichem Fehlverhalten interessiert mich empirisch nicht. Mich interessiert die Veränderung der Zitierkultur und warum in Österreich oftmals so laxe Ansichten und Regeln herrschen.
Auf Twitter schreiben Sie, mit Zadićs Arbeit beauftragt worden zu sein. "Kein Plagiat, da alle Quellen angegeben. Aber diskutable Zitierweise, da zu viel abgeschrieben.“ Wenn es sich um kein Plagiat handelt, warum gehen Sie damit an die Öffentlichkeit?
Doktorarbeiten sind öffentlich zugänglich, mittlerweile für jeden kostenlos im Internet! Natürlich ist es von der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit her gedeckt, dass man sich mit diesen Arbeiten auch öffentlich beschäftigt. Eigentlich ist es absurd, dass man darauf überhaupt hinweisen muss, denn die Online-Veröffentlichung erfolgt ja zu diesem Zweck. Zur Dissertation von Frau Zadić, die ebenfalls als Volltext für jeden frei zugänglich ist: Eine Softwareprüfung hat im Jahr 2020 kein Plagiat zutage gefördert. Mittlerweile weiß ich auch, warum: Es liegt an der Art, wie Frau Zadić Synonymplagiarismus betrieben hat, das heißt die Ersetzung weniger Wörter pro Satz. Diesen Plagiatstyp erkennt nur das Hirn, der Verstand. Seit gestern trifft die Aussage "Kein Plagiat“ übrigens nicht mehr zu, denn ich habe vier Plagiatsfragmente gefunden, davon ein schwerwiegendes in der "eigenen“ Schlussfolgerung.
Ähnliches gilt für die Arbeit von ÖVP-Ministerin Raab, die Sie teils als "Quatsch“ bezeichnet haben. Das ist keine wissenschaftliche Kategorie. Warum publizieren Sie Dinge, die laut Ihrer Expertise keine Plagiate sind und schaden damit den Geprüften wie wohl auch Ihrer eigenen Kredibilität?
Nein, Ähnliches gilt nicht für Ministerin Raab. Das waren von vornherein Plagiate, das kann jeder auf meinem Blog nachlesen. Da sind die entsprechenden Stellen dargestellt. Und ja, wenn Frau Raab schreibt, dass sich der Begriff "freiwilliges Engagement“ am besten in den internationalen Sprachgebrauch einfügt, dann ist das Quatsch, weil im von Frau Raab falsch abgeschriebenen Original der Begriff "Volunteering“ steht. Und Viktor Frankl dreimal im Fließtext "Frank“ zu nennen, das ist auch peinlich. Sowas darf in einer öffentlich entlehnbaren Diplomarbeit einer Multiressort-Ministerin nicht stehen. Sorry, aber was ist hier aus Werten wie korrekter Quellenarbeit und Präzision geworden?
Wie viel bekommen Sie für eine Plagiatsprüfung wie jene von Zadićs Dissertation bezahlt?
Die kursorische Softwareprüfung im Jahr 2020 wurde von einer Privatperson bezahlt, mit einer Summe im weit unteren vierstelligen Bereich. Die derzeitige Plagiatsprüfung dieser Dissertation erfolgt unbezahlt. Es ist die wissenschaftliche Neugierde, der Ansporn, den Subtext unter dem Text freizulegen, der mich antreibt. Das ist für mich so eine Art Text-Archäologie, ich verstehe das auch als wissenschaftliches Arbeiten.
Zu Zadićs Arbeit äußerte sich Ingeborg Zerbes, Stv. Vorständin des Instituts für Strafrecht und Kriminologie, an dem die Arbeit 2017 eingereicht wurde. Zerbes sagt, die von Zadić verwendete Zitierregel sei „lege artis“. Sie sprechen indes mittlerweile von einem "klaren Plagiat“, das Sie wie belegen? Heißt das im Umkehrschluss, dass Zerbes' Urteil falsch ist?
Ach, kann das Frau Zerbes innerhalb kürzester Zeit beurteilen? Sie war doch weder Betreuerin noch Begutachterin. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder Frau Zerbes toleriert selbst falsche und sinnfreie Zitierregeln, die es so weder in Deutschland noch England noch Amerika gibt, oder sie stellt sich einfach mal schützend vor Kollegen. Oder natürlich beides.
Kann es sein, dass Ihre heutigen Qualitätsmaßstäbe für wissenschaftliches Arbeiten an Fakultäten nicht mehr gelehrt wie gelernt werden?
Das Gegenteil ist der Fall! Seit 2012 gilt etwa für juristische Arbeiten in Deutschland diese Richtlinie. Da würden einige in Österreich schaudern. Ich bin dran, hier mit dem Ministerium die Zitierstandards besser zu kommunizieren. Man ist hier auch sehr an zukünftiger Qualitätssicherung interessiert, und ich verstehe es auch, dass mein derzeitiges "Geschäftsmodell“ der Plagiatsprüfung missfällt. Es spricht ja nichts dagegen, daraus endlich eine Wissenschaftsdisziplin zu machen.
Von 15 Personen, die er von 2007 bis 2021 des Plagiats bezichtigt hat, sind elf Männer und vier Frauen. Mit Raab und Zadić kamen nun zwei Frauen dazu. Weber weist auch darauf hin, dass die Personen der SPÖ, der ÖVP und den Grünen angehörten bzw. er sich auch den FPÖ-Historikerbericht vorgenommen hat. „Der Zusammenhang von Geschlecht oder Parteizugehörigkeit und wissenschaftlichem Fehlverhalten interessiert mich empirisch nicht. Mich interessiert die Veränderung der Zitierkultur und warum in Österreich oftmals so laxe Ansichten und Regeln herrschen“, sagt er. In Zadićs Dissertation habe er nun nach erneuter Sichtung vier Plagiatsfragmente gefunden, davon „ein schwerwiegendes in den ‚eigenen‘ Schlussfolgerungen“. Aus dem Justizministerium heißt es dazu auf Anfrage, man habe nichts zum bisher Gesagten hinzuzufügen, die Vorwürfe seien „absolut unseriös und falsch“.

Justizministerin Alma Zadic: "Vorwürfe sind unseriös und falsch"
Auch Ingeborg Zerbes, Stv. Vorständin des Instituts für Strafrecht und Kriminologie, an dem die Arbeit 2017 eingereicht wurde, bezeichnete die Arbeit als „völlig in Ordnung“. Zerbes leitete 2020/21 die von Innen- und Justizministerium eingesetzte Untersuchungskommission zu den Terroranschlägen in Wien. Zerbes verweist darauf, dass die Suchmaschinen, mit denen Plagiate gesucht werden, fehleranfällig sein können und einer „Nachkontrolle aus fachlicher Perspektive“ bedürfen. Weber hält dagegen: „Kann Frau Zerbes das innerhalb kürzester Zeit beurteilen? Sie war doch weder Betreuerin noch Begutachterin.“
Im Bezug auf Raabs Arbeit spricht Weber nicht von Plagiat, aber: „Was ist aus Werten wie korrekter Quellenarbeit und Präzision geworden?“
„Geschäftsmodell“ Abseits der Debatte um eine politische Agenda taucht immer öfter die Frage nach den Auftraggebern Webers und der Bezahlung auf. Tatsächlich wird Weber teilweise beauftragt, wie er dem KURIER sagt. Im Falle Zadićs sei eine „kursorische Softwareprüfung“ im Jahr 2020 von einer Privatperson bezahlt worden – mit einer Summe im „weit unteren vierstelligen Bereich“, so Weber.
Die Prüfung der Dissertation erfolge unbezahlt. „Es ist die wissenschaftliche Neugierde, der Ansporn, den Subtext unter dem Text freizulegen, der mich antreibt. Das ist für mich so eine Art Text-Archäologie, ich verstehe das auch als wissenschaftliches Arbeiten“, sagt Weber. Er verstehe, dass sein „Geschäftsmodell“ der Plagiatsprüfung auf Missfallen stößt. „Es spricht nichts dagegen, daraus endlich eine Wissenschaftsdisziplin zu machen.“ In Deutschland würden seit 2012 für juristische Arbeiten viel strengere Regeln gelten. „Da würden einige in Österreich schaudern. Ich bin dran, mit dem Ministerium die Zitierstandards besser zu kommunizieren.“

Kommentare