Die Corona-Protokolle: Was alles schiefgelaufen ist

Es gibt keine Namen. Eine Anwesenheitsliste? Das ja. Aber wer genau was im "Beraterstab der Taskforce Corona" gesagt hat, das ist in den zugänglichen Protokollen dieses hochrangigen Gremiums nicht vermerkt.
Die Virologen, Mathematiker und Epidemiologen sollen vor Repressionen und Anfeindungen geschützt werden. Und das ist irgendwie nachvollziehbar. Immerhin geht es bei den Treffen um elementare Fragen. Fragen wie "Können Masken die Epidemie wirklich bremsen?" oder "Wie gefährlich sind öffentliche Verkehrsmittel für die Ansteckung?"
Seit Februar trifft sich der Beraterstab des Gesundheitsministeriums regelmäßig. Und dessen Protokolle sind eine Offenbarung. Dahingehend, was Experten und die Bevölkerung seit damals gelernt haben; aber auch, was alles schiefgelaufen ist.
Der KURIER bringt einen Auszug der wichtigsten Sitzungstage:
28. Februar, die Premiere
Zu Mittag um halb eins trifft sich im Gesundheitsministerium zum ersten Mal der Beraterstab der Taskforce Corona. Die Teilnehmer – darunter Fachleute aus dem Haus sowie Österreichs renommierteste Epidemiologen und Virologen – stellen sich vor. Es wird vorab klargestellt, dass die Experten als Einzelpersonen keine Haftungen für ihre Einschätzungen übernehmen – im Hinblick darauf, was Wochen später mit dem Lockdown und dem Milliarden Euro teuren Herunterfahren der Wirtschaft passiert, ist das nicht ganz irrelevant.
Die Stimmung ist ernst: Ein Experte warnt, die Reagenzien, die man für die Covid-19-Testungen braucht, würden bereits knapp. Außerdem seien momentan in Österreich maximal 1.200 Tests pro Tag zu schaffen (zum Vergleich: bei den Massentests vor wenigen Tagen war Wien allein auf 150.000 Tests pro Tag eingestellt). Schon an diesem ersten Sitzungstag ist klar: Es gibt zu wenig Schutzausrüstung, um die mögliche Epidemie zu stemmen. Die Experten überlegen daher, ob man nicht alle im Land vorhandenen Schutzmasken einsammeln und für die Spitäler zurückhalten muss.
3. März, die ersten Modellrechnungen
Im Vergleich zur ersten Sitzung ist die Stimmung noch angespannter. Es ist unumstößlich: Masken und Schutzanzüge werden knapp werden. Also wird diskutiert, ob das vorhandene Material mit Alkohol, Chemikalien, UV-Licht oder Kobalt desinfiziert und wiederverwendet werden könnte.
Erste mathematische Modelle machen die Runde: Ab einer Prävalenz von fünf Prozent, also 450.000 Kranken, kollabiere das Gesundheitssystem, heißt es.
Laut europäischer Seuchenbehörde wären alle Menschen, die mit einem Corona-Kranken ein öffentliches Verkehrsmittel teilen, Kontaktpersonen. Der Beraterstab verwirft das: Es sei "praktisch kaum durchführbar".
9. März, Ischgl wird erstmals erwähnt
Gesundheitsminister Rudolf Anschober eröffnet die Sitzung mit einer Klage: Europa tritt nicht geschlossen auf, jedes Land entscheidet selbst, ob Fußballstadien gesperrt und Konzerte abgesagt werden. Das Exportverbot der Deutschen wird "problematisch gesehen" – eine höfliche Umschreibung der Realität. Tatsächlich stehen Lkw mit bezahlter Schutzkleidung für Österreich an der Grenze in Bayern und dürfen nicht ausreisen.
Zum ersten Mal werden Intensivstationen als "Bottlenecks" bezeichnet. Auch ein Tiroler Bergdorf wird erwähnt: In "Ischgl" sei es "offenbar zu zahlreichen Übertragungen in einer Diskothek" gekommen.
Der Beraterstab ist sich einig, dass ältere Menschen in Heimen geschützt werden müssen. "Kinder müssen von den Großeltern ferngehalten werden", fordert ein Mitglied. Das Problem dabei: Derzeit sei "nicht das Bewusstsein da, dass sich die Menschen entsprechend verhalten".
Auch eine Idee, die nie realisiert wird, kommt plötzlich auf den Tisch: Es wird über ein "Lazarett-Modell" nachgedacht. Der Plan: Es soll "Hotels" geben, in denen Patienten versorgt werden, die nicht alleine zu Hause bleiben können, die aber "zu gesund" fürs Spital sind.
Ein Experte bringt in der Sitzung eine Rechnung, die alles dominieren wird, was die Regierung in den nächsten Tagen kommuniziert: Minus 25 Prozent bei Kontakten heißt minus 58 Prozent bei den Erkrankungsspitzen.
Ein Teilnehmer warnt mit einer Aussage, die heute so stimmt wie damals: Die größte Gefahr in der Pandemie gehe von "privaten Feiern" aus.
12. März, die Warnung vor der "Kernschmelze"
Zum ersten Mal ist Bundeskanzler Sebastian Kurz im Gremium mit dabei. Die WHO hat Covid-19 mittlerweile zur Pandemie ausgerufen. Es ist der Tag, bevor der erste Lockdown verkündet wird. Einzelne Kommissionsmitglieder verzweifeln an den Bürgern: "Es gibt kein Erwachen der Bevölkerung", befindet einer verbittert – und das obwohl die "Kernschmelze des Gesundheitssystems" drohe.
Die Mobilfunkanbieter machen der Regierung ein Angebot: Man könne jedem Österreicher ein Info-SMS schicken. Die großen Lebensmittelkonzerne sind ebenfalls alarmiert: Zwar ist genug Ware für mehrere Wochen vorhanden. Trotzdem drohen in den Zentrallagern Engpässe, weil Mitarbeiter aus Ungarn und der Slowakei nicht zur Arbeit erscheinen dürfen – die Grenzen sind dicht. Nun soll das Bundesheer aushelfen.
Die Haltung der Bevölkerung macht den Experten ernsthafte Sorge. Was aber tun? Ein Experte bringt das Beispiel Großbritannien: Die Masernepidemie in den 90ern wird als Erfolgsmodell beschrieben – man habe mit der Angst der Bevölkerung gearbeitet. Die Österreicher müssten vor einer Ansteckung Angst haben bzw. Angst davor bekommen, dass Angehörige sterben. Im Gegenzug sei ihnen die Sorge vor einer Lebensmittelknappheit zu nehmen.
9. April, der Impfstoff ist der Hoffnungsträger
Ein Mitglied der Kommission fragt offen, ob man langfristig an die Herdenimmunität glaubt. Das wird aus vielerlei Gründen auch vom Gesundheitsminister verneint. Es gibt ab diesem Tag nur eine Hoffnung: eine Impfung.
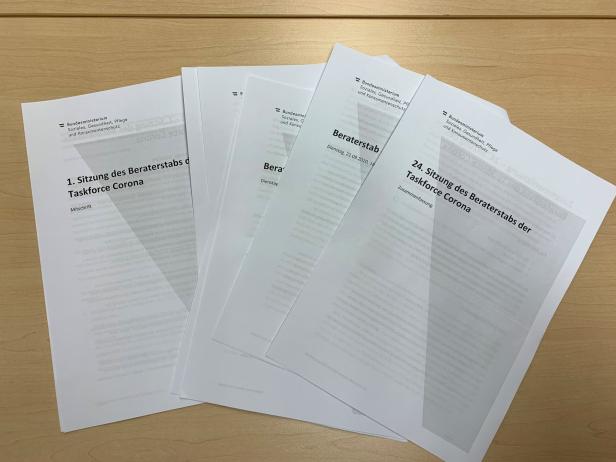
Die Sitzungsprotokolle des Beraterstabs sind öffentlich – aber anonymisiert
9. September, die Pandemie ist offenbar vergessen
Nach einer längeren Sommerpause mit vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen und wenig Koordinationsbedarf schwant den Experten Übles: Einzelne äußern das Gefühl, dass die Österreicher keine Lust mehr auf Abstand und die Verwendung von Masken haben. Stattdessen verhalte man sich, "als hätte es die Pandemie nie gegeben". Ein Problem bemängeln Sitzungsteilnehmer unverändert: Immer noch warte man vier bis fünf Tage auf ein Testergebnis.
Bemerkenswert ist, was unter Tagesordnungspunkt 1 über die Infektionszahlen steht: "In der vergangenen Gefahreneinschätzung […] wurde kommuniziert, dass es bei ca. 90 Neuinfektionen pro Tag problematisch würde."
22. September, die Bevölkerung ist gespalten
Die Expertenrunde ortet ein großes Problem im Vergleich zum Frühjahr: Es komme derzeit "zu einer Spaltung der Bevölkerung" – ein Teil sei "nicht mehr bereit, alle Maßnahmen mitzutragen".
8. Oktober, die Krise ist auch ein Geschäft
Die Experten unterhalten sich unter anderem über die Corona-Tests, und es wird klar, dass die Pandemie – auch – ein Geschäft ist. Bis zu 200 Euro verrechnen Privatlabore für die Diagnostik. Die staatsnahe AGES sagt, sie schafft es um 50 bis 55 Euro pro Fall. Ein Sitzungsteilnehmer bietet daraufhin an, noch einmal Gespräche mit Vertretern der Privatlabors zu führen.
27. Oktober, das Schwindeln beim Contact-Tracing
Warum die Infektionszahlen nun so dramatisch steigen, ist nicht endgültig geklärt. Klar ist nur: Die Österreicher machen nicht mehr mit beim Contact-Tracing und zeigen das, was Experten "Ausweichverhalten" nennen: "1∕3 der infizierten Personen", so wird nüchtern festgehalten, gebe "die Kontaktpersonen nicht richtig an".
9. November, die Angst vor der Quarantäne
Die Berater bemerken, dass die Österreicher des Testens müde sind. Der Grund: Sie haben „Angst vor Konsequenzen“ – Quarantäne und Jobverlust sind wichtiger als das Wissen um die eigene Gesundheit.
17. November, die Skepsis gegenüber den Massentests
Im letzten verfügbaren Protokoll wird festgehalten, dass sich "ein wesentlicher Teil des Beraterstabs" gegen die Massentestungen ausspricht. Der Grund: Es werde eine "falsche Zuversicht" vermittelt, dass man damit "ein normales Weihnachtsfest mit der Familie" haben könne.
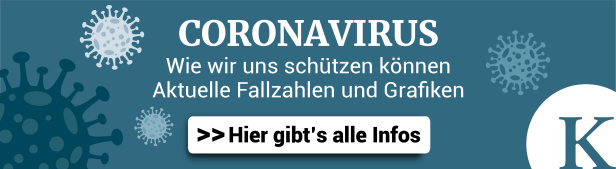

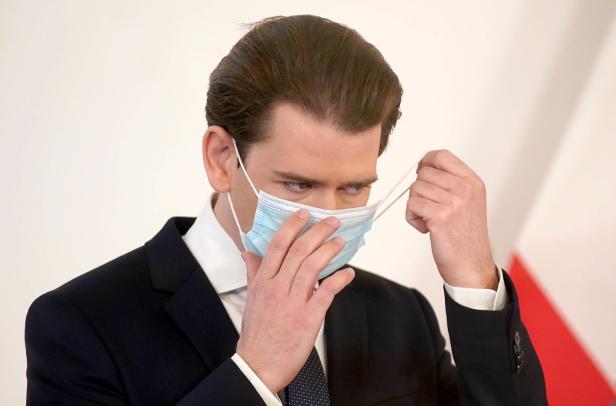






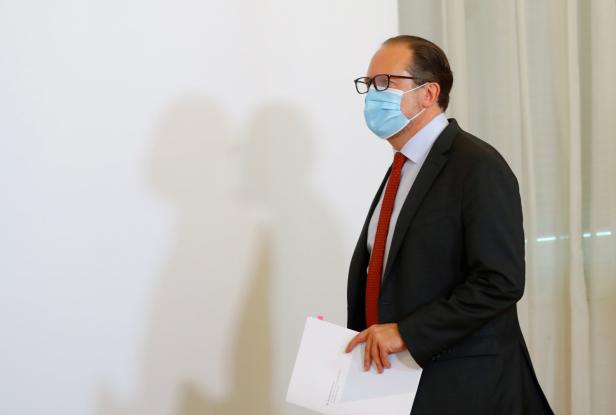

















Kommentare