Wenn Weiß-Sein die Norm ist: Wie Alltagsrassismus in Österreich aussieht

Die wenigsten würden sich wohl selbst als rassistisch bezeichnen. Rassisten, das sind die anderen. Dass sich aber auch in scheinbar harmlosen Alltagsfragen oft Vorurteile verstecken können, ist vielen nicht bewusst. Genau da setzt das Buch „War das jetzt rassistisch?“ an. Geschrieben und herausgegeben vom Team des Black-Voices-Volksbegehrens, sollen damit jene abgeholt werden, die sich bei dem Thema unsicher fühlen und mehr über die Lebenssituation von People of Color in Österreich wissen wollen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen.
Dabei ist den Autorinnen und Autoren wichtig, Rassismus nicht mit „böse sein“ gleichzusetzen. „Man denkt sich gern, dass Rassismus etwas ist, das nur von Rechtsextremen und Neonazis gelebt wird“, sagt Melanie Kandlbauer, gemeinsam mit Schwester Minitta eine der Herausgeberinnen des Buches, im Gespräch mit dem KURIER. Dadurch entstehe automatisch eine Abwehrhaltung, die eine sachliche Diskussion erschwere. Dabei sei Rassismus eine Ideologie und keine Charaktereigenschaft. „Es ist wichtig zu erkennen, dass wir alle in einer Welt leben, in der wir beispielsweise in der Schule über Afrika nur als ‚Kontinent der Armut’ lernen, und die positiven Gegenbeispiele völlig fehlen. Das macht natürlich etwas mit unserem Denken.“
Hinterfragen
Im Alltag geschehen diese Verschiebungen und Auslassungen oft ganz nebenbei. Darum sei es so wichtig, darüber zu reflektieren, dass in unserer Gesellschaft Weiß-Sein die Norm ist – und was das in Folge bedeutet. „Man schlägt ein Buch auf und nimmt automatisch an, dass die Hauptfigur weiß ist, wenn keine Hautfarbe genannt wird. Hingegen werden People of Color immer als ‚die anderen’ markiert“, erklärt Melanie Kandlbauer.
Als Teil der Mehrheitsgesellschaft würde man derlei oft einfach nicht hinterfragen. Dass hellbeige Nylonstrümpfe als „hautfarben“ ausgewiesen werden, wo es aber Hautfarben in allen Schattierungen gibt, sei nur eines von vielen Beispielen.

Farbenblind
Konfrontiere man andere mit dieser Tatsache, komme dann oft das Statement: „Für mich sind alle Menschen gleich, ich sehe keine Farben“. Ganz so einfach ist es aber leider nicht, sagen die Schwestern. Denn schließlich sind ja nicht die Farben das Problem, sondern deren Bewertung: „Natürlich wäre es schön, wenn wir uns alle nur als Menschen wahrnehmen könnten. Aber es ist einfach so, dass die Hautfarbe in vielen Kontexten eine Rolle spielt. Wir sind alle gleich, aber wir werden nicht alle gleich behandelt.“ Das äußert sich oft ganz subtil, man spricht in diesem Zusammenhang auch von „Mikroaggressionen“.
Minitta Kandlbauer erklärt, was dahinter steckt: „Ein klassisches Beispiel ist die Frage ,Woher kommst du?’. Die ist darum so anstrengend, weil sie People of Color wirklich die ganze Zeit gestellt wird. An der Kassa, kurz vor Prüfungen, ... Ich habe das wirklich überall erlebt. Dabei ich bin ja tatsächlich Österreicherin, habe eine österreichische Familie, mein Nachname ist Kandlbauer – aber ich muss meine Herkunft trotzdem immer erklären. Oft sogar, bevor man überhaupt meinen Namen wissen will.“ Es sei wie bei Mückenstichen, ergänzt Schwester Melanie. Einer ist kein Problem, viele aber extrem unangenehm.
Antirassismus-Volksbegehren
Eine antirassistische Initiative in Österreich mit dem Zweck, die institutionelle, repräsentative, gesundheitliche, bildungspolitische, arbeitsrelevante und sozioökonomische Stellung für Schwarze Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft und People of Color mit bundesverfassungsrechtlichen Maßnahmen zu verbessern und zu stärken
Eintragungswoche
Bis 26. September, per Handy-Signatur und in jedem Gemeindeamt. Info: blackvoices.at
Buch
Black Voices: „War das jetzt rassistisch?“
Leykam Verlag. 224 Seiten. 23,50 Euro
Machtspiel Sprache
Dass das Thema emotional stark aufgeladen ist, merkt man auch an den immer wieder heftig aufflammenden Debatten rund um die sogenannte politisch korrekte Sprache. Ein Thema, das besonders Minitta Kandlbauer wichtig ist. „Ich habe selbst Germanistik studiert. In meiner Masterarbeit bin ich der Frage nachgegangen, wie man analysieren kann, ob Wörter diskriminierend sind oder nicht. Kurz gesagt: es ist ein enormer Machtkampf“. Begriffe wie beispielsweise das N-Wort seien im Wörterbuch schon lange als abwertend markiert – das wird aber oft nicht akzeptiert.
„Ein Argument, das dann kommt: ‚Für mich persönlich ist das aber nicht so!’ Dabei ist das N-Wort ganz klar herabsetzend“, sagt Minitta Kandlbauer. „Natürlich kann jemand, der nicht mit dieser Bezeichnung beschimpft wird, dessen ganze Bedeutung nicht erfassen. Ich verstehe schon, dass es dann eine andere Bedeutung hat.“ Wolle man aber die ganze Dimension eines Wortes begreifen, zähle in erster Linie dessen allgemeine Verwendung in der Sprache – und nicht der individuelle Sprachgebrauch.
Einfach nur zuhören
Es gehe dabei, ergänzt Melanie Kandlbauer, auch um folgende Frage: „Wer darf wen benennen, wer behält die Deutungshoheit. In meiner Arbeit als Antirassismustrainerin werde ich immer wieder gefragt: ‚Welche Bezeichnung kann ich für diese Gruppe Menschen verwenden?’“ Am einfachsten sei es dann zu überlegen: Ist es eine Selbst- oder eine Fremdbezeichnung? Bei einer Selbstbezeichnung sei man auf der sicheren Seite, weil man respektiere, dass Menschen sich selbst benennen dürfen.
Wen all diese Punkte überfordern, den will Minitta Kandlbauer beruhigen: „Es ist kein leichtes Thema und man muss nicht alles wissen. Ganz wichtig ist aber, Betroffenen einfach einmal nur zuzuhören.“ Immer ein guter erster Schritt.

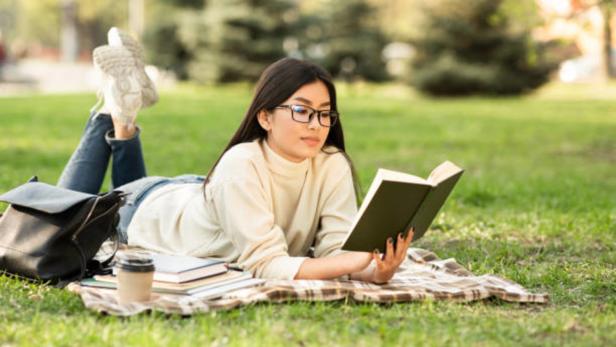

Kommentare