Von Schmerz und Tod auf der Lungenkrebs-Station

90 Minuten lang tropft die aggressive Flüssigkeit aus dem Infusionsbeutel in Silvias Venen. Das Zellgift strömt von ihren Venen direkt in Silvias Herz. Und ihr Herz wird das Gift weiter in ihren ganzen Körper pumpen. Silvias Haare sind ganz kurz und struppig. Einige Kilos hat sie schon verloren.
Dennoch lächelt sie viel. Die kleine, zierliche Frau hat ihr Leben lang in der Gastronomie gearbeitet und war selbst starke Raucherin. Über viele Jahrzehnte hinweg. Vor einiger Zeit hatte sie einen Schlaganfall. Im Zuge der Untersuchungen haben die Ärzte einen Tumor entdeckt. Er wächst in Silvias Lunge. Keine Operation könnte sie heilen.
Deshalb sitzt Silvia heute im Pavillon Leopold I des Otto-Wagner-Spitals im 14. Wiener Gemeindebezirk. Dreimal die Woche muss sie hier auf einem der Sessel der onkologischen Tagesklinik Platz nehmen und sich die Chemotherapie verabreichen lassen. Silvia nimmt immer eine Tageszeitung mit, um sich die Zeit zu vertreiben. Sie befindet sich bereits im zweiten Zyklus der Chemotherapie. Die nächste Besprechung mit ihrem Arzt ist für Ende März angesetzt.
„Heute geht es mir recht gut“, sagt Silvia. „Als ich die Diagnose Lungenkrebs erhalten habe, war ich so dumm und habe nicht einmal da sofort mit dem Rauchen aufgehört. Das bereue ich jetzt sehr.“ Ihr Blick gleicht der einer besorgten Großmutter. Und dann ist es wieder da, das liebe Lächeln der hageren Frau.
Sie blättert in der Zeitung um. „Ich möchte jedem da draußen sagen: Hör sofort auf mit dem Rauchen. Du ruinierst dir das ganze Leben. Ich hänge ständig am Sauerstoff. Tag und Nacht brauch ich den Sauerstoff.“ Zusätzlich zum Lungenkrebs leidet Silvia – wie fast alle starken Raucher – an der schweren Lungenkrankheit COPD. Chronische Atemnot.
Ohne von außen zugeführten Sauerstoff kann Silvia nichts mehr tun. Und selbst mit, ist jede Tätigkeit oder Bewegung enorm anstrengend für sie. „Das Duschen, das Einkaufen, das Stufensteigen. Alles ist sehr schwer für mich geworden“, erzählt sie und schüttelt ganz leicht den Kopf über sich selbst.

Lungenkrebspatientin Silvia
Lungenkrebs ist zu 90 Prozent mit dem Rauchen assoziiert. Der Rest teilt sich auf Asbestkontakt, Passivrauchen oder genetische Veranlagungen auf. Jede Zigarette enthält 40 bis 70 Giftstoffe, die eine oder mehrere von 15 Krebserkrankungen auslösen.
Beim Verbrennen von Tabak entstehen Feinstaub, gasförmige Schadstoffe und organische Aerosole, die für chronische Entzündungen, Krebs- und Herzkreislauferkrankungen verantwortlich sind. Dies bewirkt eine Fehlsteuerung und Umprogrammierung der Gene und eine entsprechende Funktionsstörung der Zellen.
Bei einer Packung Zigaretten pro Tag kommt es über das Jahr in den Atemwegen zu 150 Mutationen. Aus den schwer wiegenden entwickeln sich nach 20 bis 30 Jahren Tumore oder eine Zerstörung der Lunge, die berüchtigte COPD.

Lungengewebe (grau) und weißlich rund der Lungenkrebs
Die Lebenszeit von Rauchern verkürzt sich im statistischen Schnitt um rund acht Jahre. Die letzten Zahlen wurden von der Statistik Austria im Jahr 2014 erhoben. Demnach entwickelten sich die Raucherquoten für die Geschlechter konträr. In den 1970er Jahren rauchten 39 Prozent der männlichen und 10 Prozent der weiblichen heimischen Bevölkerung.
Über die Jahre nahm bei den Männern der Anteil der täglich Rauchenden kontinuierlich ab und liegt nun um zwölf Prozentpunkte niedriger, nämlich bei 27 Prozent. Bei den Frauen zeigte sich ein gegenteiliger Trend. Der Anteil der Raucherinnen stieg um insgesamt zwölf Prozentpunkte auf 22 Prozent an. Etwa 14.000 Österreicher sterben jährlich vorzeitig an den Folgen des Tabakkonsums.
Es schmerzt erst, wenn es zu spät ist
Starke Raucher haben schlechtere Zähne, braune Finger und gelbe Schnauzer. Beim Raucher legt sich nicht nur die Haut, sondern auch die Lunge früher in Falten. Der Raucherhusten ist ein Frühsymptom, die Atemnot folgt später. Das Lungenkrebsrisiko eines Rauchers ist mindestens zehnmal höher als das eines Nie-Rauchers. Lungenkrebs löst erst Schmerz aus, wenn er Komplikationen bereitet oder er die Lunge verlassen hat. Die Heilungschancen liegen bei nur 15 Prozent.
Aber auch bei anderen Krebsformen wie Kehlkopf-, Zungen-, Kiefer- und Mundhöhlenkrebs ist die Raucherkonzentration hoch. 30 Prozent aller Nierenkrebsfälle werden dem Rauchen zugeschrieben. Beim Blasenkarzinom ist Rauch für 50 Prozent bei den Männern und für ein Drittel bei den Frauen verantwortlich. Der Urin, der sich zwischen dem Harnlassen in der Blase sammelt, ist bei Rauchern reich an Schadstoffen. Auch der übrige Körper wird mit Schadstoffen überflutet.
Der Arzt und seine Patienten
„Diese Frau ist mit Inbrunst Raucherin gewesen“, sagt der Onkologe Maximilian Hochmair über seine Patientin Silvia. Seine Worte sind laut und bestimmt, aber immer freundlich. Schon fast im Laufschritt führt er durch den Pavillon. „Ich fahre immer mit dem Rad in die Arbeit, das hält fit“, sagt er. Nikotin selbst sei nichts Schlechtes.
„Dies ist eine grenzgeniale Droge. Wenn Sie aufgeregt sind, holt es Sie runter. Sind Sie müde, kurbelt es sie an. Man kann es als Kaugummi oder durch ein Pflaster zu sich nehmen - oder durch einen kleinen Inhalator über die Mundschleimhaut.“ Aber die Kombination mit dem Rauchen sei eine Katastrophe.
Hochmair, 40, ist mehrfacher Familienvater und Leiter der Lungenkrebsambulanz im Otto-Wagner-Spital. Er ist sportlich, lebt gesund und hat noch nie eine Zigarette angerührt. Der Arzt lebt also ziemlich genau das Gegenteil vieler seiner Patienten. Hochmair muss jemanden nicht rauchen sehen, um zu wissen, dass er Raucher ist. „Alleine das Hautbild spricht Bände“, sagt der Lungenfachmediziner, der seit 18 Jahren in seinem Bereich tätig ist.
„Ich sehe den Schmerz, ich sehe den Tod“
Die politische Wende um das Rauchverbot im Jahr 2018 und damit einhergehend den Nichtraucherschutz in der heimischen Gastronomie machte den Arzt damals völlig fassungslos. „Als Mediziner ist mir das komplett unverständlich, auch im Namen meiner Patienten." Dass nun das Gastro-Rauchverbot ab November kommen soll, kann er nur begrüßen.
Laut den jüngsten verfügbaren Zahlen gab es im Jahr 2015 in Österreich 4860 Lungenkrebs-Neuerkrankungen, 3.900 endeten im selben Jahr tödlich. "Tendenz steigend“, sagt Hochmair. Was strengere Nichtrauchergesetze bewirken können, sehe man in den USA. „Dort ist die Zahl der Erkrankungen dramatisch zurückgegangen. Innerhalb von zehn Jahren gab es dort um die Hälfte weniger Lungenkrebs-Patienten“, sagt Hochmair. Eine dahingehend verantwortungsvolle Politik mache sich also mehr als bezahlt. Österreich sei im europäischen Nichtraucherschutzbereich derzeit leider letztplatziert.
„Ich gehe vom Leid der Patienten aus. Ich sehe hier auf meinem Pavillon den Schmerz, ich sehe den Tod. Aufgrund dieser Krankheit. Wegen dem Rauchen. „Warum war ich jemals so deppad und hab’ eine Zigarette angegriffen?“, diesen Satz hört Hochmair täglich.
„Ich will diesen Menschen hier helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Das Suchtverhalten muss behandelt werden. Oder noch besser, sie fangen erst gar nicht an. Wir müssen hier als Gesellschaft eine Vorbildfunktion einnehmen. Nichtrauchergesetze für die Gastronomie wären daher ein enorm wichtiger Schritt. Wir alle würden davon profitieren“, sagt Hochmair, der auch über das Herunterspielen des Risikos von Passivrauch nur den Kopf schütteln kann.
Passivrauch enthält nicht nur gasförmige Substanzen, sondern auch Rauchpartikel. Diese weniger als 10 Mikrometer kleinen Partikel sind deswegen so gefährlich, weil sie tief in die Lunge gelangen. Sowohl die glimmende Zigarette als auch der Raucher selbst geben Rauch von sich. Dieser Passivrauch schädigt alle, die sich im Umfeld von Rauchern befinden.
Täglich sieht Hochmair zwei bis drei seiner Patienten sterben. Dass viele von ihnen ihre schwere Krankheit selbstverschuldet haben, ist für den Arzt kein Thema. „Wie diese Menschen ihre Krankheit bekommen haben, ist nicht mein Business. Ich bin Mediziner, ich kümmere mich um alle Patienten.“ Selbstverständlich aber sage er folgenden Satz fast täglich: „Sie hören bitte jetzt auf zu rauchen, dann leben Sie ums Doppelte länger.“
Obwohl der Arbeitsalltag oft traurig ist, fühlt er sich nie alleine. „Wir sind hier ein tolles Team und ich habe großartige Unterstützung.“ Viele seiner Patienten seien unheilbar krank und daran könne er nichts ändern. „Was man von solchen Menschen zurückbekommt, im Rahmen dieser furchtbaren Hoffnungslosigkeit: Wenn vielleicht doch noch ein Licht am Horizont erscheint, ist das wirklich ein phänomenales Gefühl“, erzählt der Arzt. Hochmair betreut täglich ungefähr 35 Patienten. Sein Telefon läutet alle zehn Minuten.
Im Pausenraum sitzen zwei junge Krankenschwestern und rauchen eine Zigarette, während eine gebrechliche Lungenkrebs-Patientin samt Sauerstoffflasche und Infusionswagen hustend vorbeischleicht. Ein verstörender Anblick. Diese Krankenschwestern sehen das tägliche Leid und den Schmerz dieser Patienten. „Sie wissen genau, wie es bei ihnen sein wird. Dennoch rauchen sie“, sagt Hochmair. Mehr nicht.
Hochmair sagt seinen unheilbar kranken Lungenkrebs-Patienten nicht, dass sie nur noch sechs Monate leben werden. „Ich sage ihnen, dass ihre Lebenszeit nun begrenzt ist. Dass sie aber noch viel dazu beitragen können, dass ihr Leben noch etwas länger andauert.“ Allen voran heißt das: Nicht mehr rauchen. Keine einzige Zigarette.
Menschen, die erfahren, dass sie todkrank sind, die erfahren, dass sie einen inoperablen Lungenkrebs haben, durchlaufen ab diesem Moment verschiedene Phasen: Depression, Aggression, Leugnung, Akzeptanz.
Bis zur letzten Stufe könne viel Zeit vergehen, sagt Hochmair. „Manche aber bekommen die Realitätswatsch’n ganz rasch und hören sofort mit dem Rauchen auf. Sie glauben nicht, wie viele Tschickpackerl schon in meinem Mistkübel hier gelandet sind.“ Er deutet in das Eck seines Büros zu dem Eimer und räumt anschließend mit einigen, wie er sagt, „Märchen“ auf.
„Wissen Sie, schon eine einzige Zigarette pro Tag ist schädlich.“ Denn auch das bedeute: etliche Schadstoffe, chronische Entzündungen und fatale gesundheitliche Konsequenzen. Ein „Ich rauche eh nicht mehr so viel“ sei daher nichts, zu dem man Gratulieren müsste. Einzig das komplette Aufhören helfe der Lunge wieder.
Das regelmäßige Rauchen ist für den Lungenkrebs der Hauptrisikofaktor. Die Kontinuität ist gefährlicher als eine einmalig große Menge. Raucht jemand über 30 Jahre lang jeden Tag nur eine einzige Zigarette, so wäre das ungesünder als viele auf einmal zu rauchen und dann nie wieder. „Jede Zigarette, die man raucht, kostet 1,5 Minuten Lebenszeit“, fährt Hochmair fort. Lungenkrebs sei ja erst die Spitze des Eisberges. „Raucher haben meist viele Nebenerkrankungen, die auch sehr gefährlich sein können. HNO-Tumore, Schlaganfälle, Herzinfarkte, COPD.“
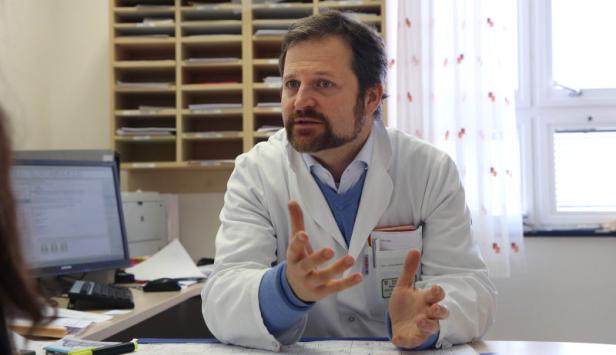
Oberarzt Maximilian Hochmair
Auch Light-Zigaretten und E-Zigaretten seien ein heikles Thema. „Erstere werden tiefer inhaliert, das Karzinom entsteht dann in der Peripherie und nicht mehr so zentral. Aber wir haben eine genauso häufige Rate von Lungenkrebs, bloß die Erkrankungsart ist anders.“
In Australien seien die bei uns gerade sehr beliebten E-Zigaretten nach wie vor verboten, weil schlichtweg keine Langzeitdaten vorhanden sind. „Auch hier wird verdampft, eine physikalische Reaktion entsteht, die genauso Nanopartikel produziert wie das Rauchen. Ob die Gefährlichkeit niedriger ist und sich ein Wechsel lohnt, kann ich derzeit ehrlich nicht sagen.“
Atemnot und Raucherbein
Wer durch den Pavillon Leopold streift, sieht schwerstkranke Menschen. Der Krebs entzieht dem Körper Energie. Sie fließt nur noch in die Krebszellen. Gewichtsverlust ist die Folge, die Menschen werden schwächer und schwächer. Je weiter die Krankheit fortschreitet, desto weniger Muskulatur bleibt übrig.
Hinzu kommen viele Zusatzerkrankungen vom Rauchen, die erschwerend wirken. „Es handelt sich hier also um rundherum kranke Menschen. Viele leiden an Atemnot oder Raucherbeinen. Der Lungenkrebs ist dann das, was sie zum Einschlafen bringt“, sagt Hochmair. Ein Drittel von Hochmairs Patienten spuckt regelmäßig Blut.
Und auch wenn die Therapien im Jahr 2018 weit mehr Möglichkeiten bieten als im Jahr 2008: Irgendwann ist der Mediziner mit seinen Optionen am Ende angelangt. Und dann stirbt der Mensch.
An diesem Punkt bleibe nur noch palliative Behandlung übrig. Den Menschen Leid zu ersparen, Schmerzen zu behandeln. Die Atemnot verringern, zum Beispiel. „Natürlich ersticken diese Patienten, aber sie haben nicht mehr das Gefühl, dass sie ersticken. Das bekommen sie aufgrund der modernen Schmerzbehandlung zum Glück nicht mit“, sagt der Arzt.
Wenn Hochmair über seinen Fachbereich spricht, läuft er zu Hochform auf. Dabei betont er, wie weit der Fortschritt in der medizinischen Forschung hierzulande gekommen sei. „Vor zehn Jahren hätte es ausschließlich die aggressive Chemotherapie als Option für Lungenkrebskranke gegeben.
Heute gebe es eine Fülle an Behandlungsmethoden, auf die ein gewisser Teil seiner Patienten positiv anspreche. „Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir können diese Menschen nach wie vor nicht heilen, aber wir gewinnen Lebenszeit. Österreich arbeitet hier wirklich auf Harvard-Niveau“, sagt Hochmair.


Seltenes Glück: CT-Aufnahmen eines Lungenkrebs-Patienten vor und nach der Immuntherapie. Die Tumore erscheinen hier dunkel.
Heute könnte er unterschiedliche Arten von Therapien, zum Beispiel auch Immuntherapien, gezielt auf den jeweiligen Patienten abstimmen. So erreiche er weniger Nebenwirkungen und er verstehe dadurch besser, wo und wie sich der Tumor bewegt und wie er sich verändert. „Da wird noch extrem viel kommen“, sagt Hochmair. „Aber alles natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die Patienten das Rauchen lassen.“
Was dem Arzt noch ganz besonders auf dem Herzen liegt: „Viele Menschen glauben, wenn sie sieben Jahre nicht mehr geraucht haben, sei alles wieder beim Alten. Aber der Schaden, der durch das Rauchen verursacht wurde, der kann nicht verschwinden.“ Beim Lungenkarzinom senke man das Risiko zu erkranken massiv, wenn man als junger Mensch wieder aufhört mit dem Rauchen. „Aber dennoch hat man ein höheres Risiko zu erkranken als jemand, der nie geraucht hat.“
Die Flüssigkeit, die immer noch in Silvias Venen tropft, soll in den Vermehrungszyklus der Krebszellen eingreifen und so das Tumorwachstum hemmen. „Ich vertrage die Chemotherapie zum Glück sehr gut. Jetzt warte ich einmal das anstehende Gespräch mit dem Doktor ab, dann sehen wir weiter“, sagt Silvia und wieder lächelt sie zum Abschied.
Dieser Artikel erschien das erste Mal am 22.3.2018 im KURIER und ist nun in aktualisierter Form zu lesen.

Kommentare