"Hana" von Alena Mornštajnová: Weiterleben, und Sinn finden

"Zum Glück weiß der Mensch nicht, was ihn erwartet“, steht mitten im Buch „Hana“, und der Leser weiß da schon längst, was die junge, titelgebende Frau erwartet.
Das macht es umso schrecklicher.
„Hana“ ist eines der erfolgreichsten Bücher der vergangenen Jahre in Tschechien. Die Autorin Alena Mornštajnová wurde mit dem Werk auch international bekannt und mehrfach übersetzt, die deutsche Übersetzung von Raija Hauck erschien nun im Wieser Verlag.
Es gibt dem zentralen Schreckensmoment des 20. Jahrhunderts eine neue Perspektive: Eine Familiengeschichte rund um drei Frauen in einer tschechischen Kleinstadt, die von den klitzekleinen Hoffnungen, dem zu normalen Zeiten lebensfüllenden Auf und Ab und den Eifersüchteleien des Alltags nach Auschwitz führt.
Und wieder zurück.
Epidemie
Es beginnt mit einer Epidemie, mit Quarantäne und überfüllten Spitälern.
„Hana“ hat eine „ungewollte Aktualisierung erfahren“, bestätigt Mornštajnová im KURIER-Gespräch. Die Typhus-Epidemie 1954 in ihrer Heimatstadt Valašské Meziříčí war jene wahre Begebenheit, von der aus Mornštajnová das Buch entworfen hat.
„Meine Großmutter erkrankte damals, sie hatte einen sehr schweren Krankheitsverlauf. Deswegen wusste ich von der Epidemie, auch wenn diese inzwischen vergessen ist.“
Die Großmutter der Autorin musste in ein 100 Kilometer entferntes Spital gebracht werden, bekam dort nur ein Bett am Gang, irrte im Delirium herum – und sprang aus dem zweiten Stockwerk in die Tiefe.
Dieser Sprung ist ein zentraler Moment in „Hana“, von dem aus sich in beide Richtungen die Familiengeschichte entspinnt. Hana und ihre Nichte Mira überleben die Epidemie – als Einzige ihrer Familie. Die aus der Sicht Miras überaus eigenartige Tante, zahnlos, weiße Haare, obwohl erst Mitte 30 (sie verteilt Brot an allen möglichen Orten ihres Hauses, und man lernt später, warum), nimmt das kleine Mädchen auf.
Und Mira erfährt nach und nach, warum Hana zwar lebt, aber über dieses Leben selbst erstaunt scheint.
Zentral sei ihr anfangs die Beziehung zwischen diesen Frauen gewesen, sagt Mornštajnová. In den Recherchen aber hat sie entdeckt, dass in ihrer Heimatstadt eine jüdische Minderheit gelebt hat, und gar nicht wenige dieser Menschen waren sich dessen selbst gar nicht oder kaum bewusst.
Auch in Hanas Familie spielte das Judentum kaum eine Rolle. Bis die Weltgeschichte über sie, ihre Kleinstadt, ihre Leben hinwegzog.
Es sind gerade die kurz zuvor noch intakten Lebenshorizonte, die in „Hana“ bewirken, dass die Schicksale der zunehmend ausgegrenzten und verfolgten, dann nach Theresienstadt transportierten und in Auschwitz ermordeten Menschen umso eindringlicher auf den Leser wirken.
Eine hauchdünne Jugendliebe verstellt Hana den Blick auf die Gefahr, sie verschleppt die Flucht. Der Leser sieht diese Entscheidung im Rückspiegel des Folgenden, er weiß, was sie erwartet, und gegen welche wertlose Währung sie das eintauscht.
Und trotzdem versteht man es: Wer sollte das glauben, voraussehen können, was folgte, das, was jetzt noch unbegreiflich ist und bleiben muss?
„Hana“ erzählt aber auch von der Zeit nach der Katastrophe. Davon, wie Mira ihrer Tante wieder Lebensinhalt schenkt. „Ich wollte zeigen, dass jedes Leben Sinn hat“, sagt Mornštajnová. „Auch wenn man sich das selbst nicht eingestehen kann. Hana hatte das Gefühl, dass sie anderen nur Unglück bringt.“
Unter der Decke
Am Schluss des Buches machen die Kreise der Schuld noch letzte Drehungen, bevor sie einrasten. Die zahlreichen Fäden des Lebens, die vor dem Einmarsch der Nationalsozialisten gesponnen und dann brutal abgeschnitten worden waren, werden aufgenommen und neu weitergewoben.
Wurde diese Zeit in Tschechien eigentlich aufgearbeitet? Mornštajnová kann das „nicht pauschal sagen, nur für meine Heimatstadt“, sagt die Autorin. „Erst nach 1989 (Ende des kommunistischen Regimes, Anm.) kamen die Schicksale der jüdischen Menschen ins Bewusstsein der Gesellschaft. Die Überlebenden kamen meist nicht zurück in ihre Heimatorte. Sie fühlten sich nicht willkommen. Und in den 1950ern gab es eine erneute Verfolgungswelle.“
Nach Valašské Meziříčí kehrte kein Einziger der 200 jüdischen Bürger zurück. „Und die Stadt hat sich auch nicht bemüht, sie zurückzuholen. Man wollte das zudecken. Eine Synagoge blieb zurück, wurde aber 1954 abgerissen.“ Erst nach dem Jahr 2000 wurde ein Denkmal aufgestellt, auf Betreiben eines Vertriebenen, der nun in England lebt – und zur wichtigen Quelle für die Autorin wurde.
Mornštajnová hat gegenüber den Opfern Schuld verspürt – und gab den Figuren in „Hana“ deswegen Namen realer Menschen, die in der jüdischen Gemeinde in Valašské Meziříčí gelebt hatten. Hana und Mira waren Kinder, die in Auschwitz ermordet wurden.
Ohne Pause
„Hana“ ist das dritte Buch der Autorin, „ich habe sehr spät mit dem Schreiben begonnen“, sagt Mornštajnová (Jahrgang 1963). Der Erfolg des vielfach ausgezeichneten und mehrfach übersetzten Buches hat sie selbst „sehr überrascht“.
Er wird sich (auch) darin begründen, dass „Hana“ keine Betroffenheitspausen einlegt. Sondern den Leser menschennah, in zugänglicher Sprache und greifbaren Bildern, in eine Stadt hineinführt. In normale Leben mit ihren rauen Ecken und ungeschliffenen Kanten. Mit der Art von Fehlern, die jeder dauernd macht und die unter den unfassbarsten Umständen dann tödlich werden.
Wie geht es einer Autorin eigentlich beim Schreiben über diesen Schrecken?
Mornštajnová erzählt von der belastenden Recherche für „Hana“, vom Anhören der Aussagen von Holocaust-Überlebenden, von Dokumentationen und vielen Büchern, die sie gelesen hat.
„Es gab einen Moment, an dem ich feststellte: Ich bin da zu tief drinnen. Und dann habe ich beschlossen: Ich werde ein Kinderbuch schreiben, in dem es nichts Böses gibt. Das war für mich eine Art Psychotherapie.“
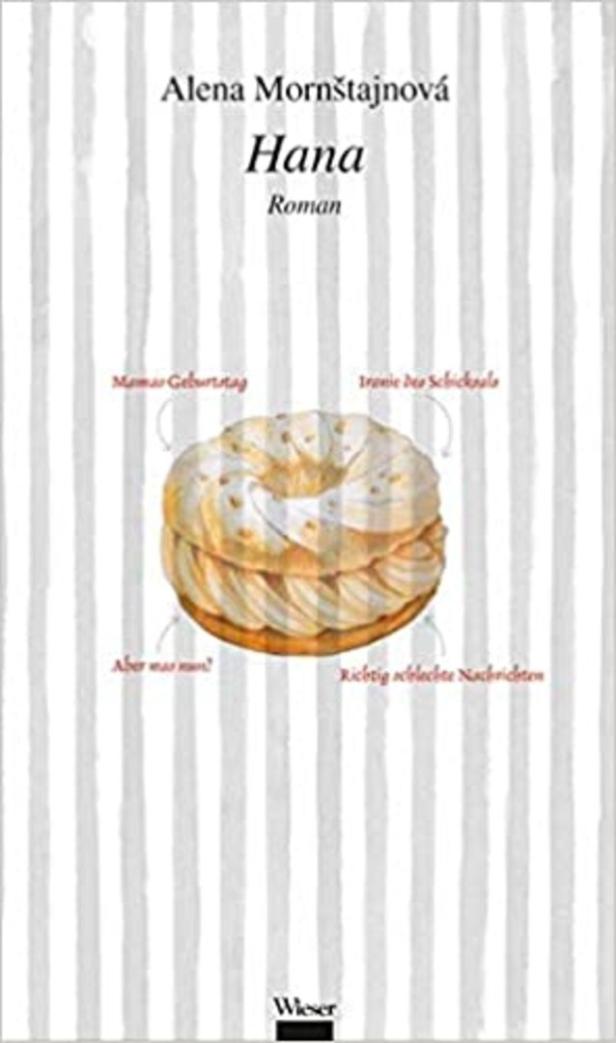




Kommentare