Lionel Shriver: Diese Frau sucht Ärger

Was wäre denn ein geeigneter Song für die Trauerfeier? „I Wanna Go Home“? Oder vielleicht „Save the Last Dance“?
Das Londoner Ehepaar Cyril und Kay Wilkinson geht auf die 80 zu. Vor dreißig Jahren, als Kays Vater nach einem jahrelangen Martyrium geistig völlig umnachtet starb, schwor sich die ehemalige Krankenschwester, niemals zu einem Pflegefall zu werden, niemals das Leben ihrer Kinder derart zu belasten. Und ihr Mann Cyril, ein Mediziner, fand, man dürfe das öffentliche Gesundheitssystem nicht mit der Pflege hochbetagter Patienten überlasten. Das Paar beschloss, kurz nach beider 80. Geburtstag Abschied von der Welt zu nehmen. Das Schlafmittel, das sie dafür verwenden wollten, schlummerte jahrzehntelang in einem Eck des Kühlschranks.
Das letzte Abendmahl
Dreißig Jahre sind schnell vergangen. Cyril entdeckt, dass er mit Ende siebzig wesentlich fitter ist, als er sich das vorgestellt hat, und engagiert sich euphorisch gegen den Brexit.
Kay hat sich in der Pension eine zweite Karriere als Innenarchitektin aufgebaut. Schmerzen hier, Schmerzen da, sie fühlt sich nicht wesentlich anders als mit zehn und im Garten funkeln die Kamelien so schön. Im letzten Jahr vor dem vereinbarten Termin stellt sie sich immer öfter die Frage, wie sie mit der kostbaren Währung der verbleibenden Lebenszeit verfahren soll. Ist eine Doku über den Verlust der Artenvielfalt im Amazonas nicht Zeitverschwendung, wenn sie nicht mehr da sein wird, um das Aussterben des Weißwangenklammeraffens zu beklagen? Was ist überhaupt noch wichtig? Soll man beim letzten Abendessen wirklich über Boris Johnson sprechen? Mit Akribie bereitet Kay ihre Trauerfeier vor, vergisst beinahe, dass sie nicht dabei sein wird. Mit der Pandemie tauchen auf dem Weg zum Selbstmord neue Hindernisse auf. Es ist Lockdown, was ist, wenn sie keiner findet? Wenn sie verwesen und das Haus unverkäuflich wird?
Lionel Shriver beschreibt in ihrem intensiven, blitzgescheiten Roman „Lass uns doch noch etwas bleiben“ ein Paar, das den Realitäten des Lebens ins Auge blicken und ihrer Herr werden will. Das Altwerden lässt sich nicht vermeiden, den Tod aber will man selbst in die Hand nehmen. Doch Abschied nehmen ist nicht so leicht, wie sie sich das vorgestellt haben. Nichts ist so, wie sie es sich vorgestellt haben. So war ihnen nicht klar, wie sehr sie es auch mit fast achtzig noch genießen würden, den Körper des anderen zu spüren.
Nach dem Prinzip, das etwa Yasmina Reza im Theaterstück „Drei Mal Leben“ angewandt hat, probiert auch Shriver hier verschiedene Versionen des Abschieds: Drei Mal Sterben, in Varianten.
Eine clevere Mischung aus Sozialkritik und Möglichkeiten von Lebensbejahung ist der in England lebenden US-amerikanischen Autorin und Journalistin hier gelungen. Pflege, Sterbehilfe, Lockdown, Brexit und der Sinn von alledem: Für und Wider werden in Dialogen zweier recht unterschiedlicher Ehepartner ausgelotet, er eher links, sie, zu seinem Schrecken, nicht unbedingt. Was auch zu sehr komischen Situationen führt – etwa, als sie ihm kurz vor dem privaten Exit gesteht, sie habe für den Brexit gestimmt.
Lionel Shriver wurde 2005 mit dem Roman „Wir müssen über Kevin reden“ über einen 16-Jährigen, der ein Schulmassaker anrichtet, bekannt. Typisch. Sie ist keine Autorin, die gefallen will. Als Kolumnistin wie als Romanautorin greift sie gerne dorthin, wo es wehtut. Ob es um Identitätspolitik, Lockdowns oder Themen wie Pflege und Sterbehilfe geht. Der New Yorker schrieb über sie: Shriver sucht Ärger.
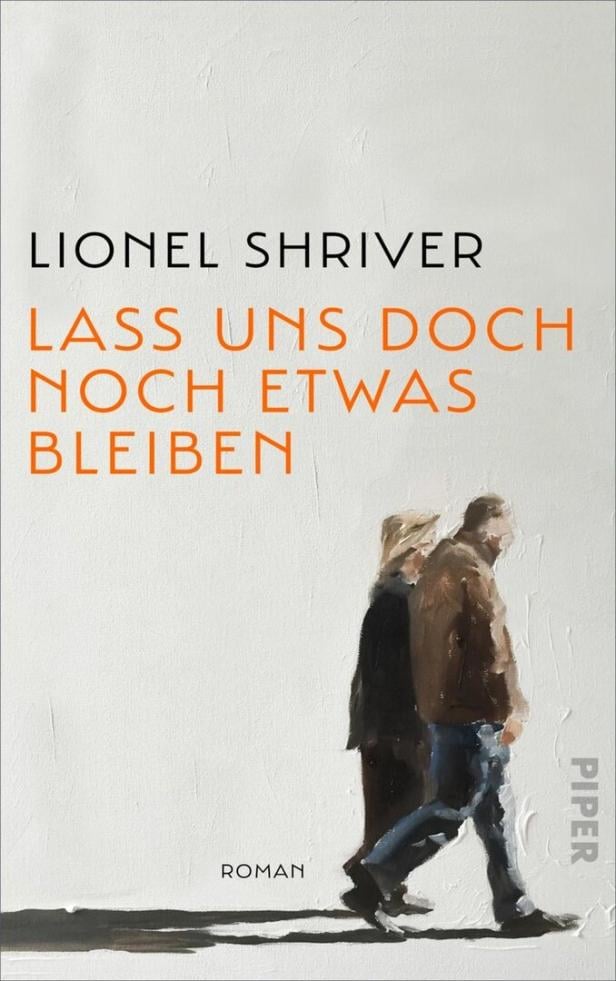
Lionel Shriver:
„Lass uns doch noch etwas bleiben“. Ü.: B. Abarnell, N. Hansen. Piper. 352 S. 25,50 €

