Elizabeth Strout: Wer die Eichhörnchen weinen hört

Eine Coronageschichte. Will man das jetzt noch lesen? Ja. Man will und man muss. Wie alles von Elizabeth Strout. Auch, weil sie Eichhörnchen weinen hört. Sie beschreibt eine Szene, in der ein Mann ein zu groß geratenes Eichhörnchennest vom Balkon fegt. Das Tier stößt noch bis zum Abend des nächsten Tages Laute aus, die wie Weinen klingen. „Das Eichhörnchen weinte und weinte und weinte. Weil man ihm sein Zuhause genommen hatte.“
Wer Elizabeth Strout liest, wird garantiert auch weinen. Vor Verzweiflung und vor Glück. Weil sie alles über die Menschen weiß – und sie trotzdem liebt. Im Original ist „Am Meer“ schon vor eineinhalb Jahren erschienen. Die Seuche saß der Menschheit damals noch in den Knochen. Aufgehört, angesichts der Weltlage rücksichtsvoll miteinander umzugehen (ein Phänomen, das Strout auch in New York wahrnahm), hatte man da längst. Die Gräben weiteten sich danach umso tiefer.
Der Originaltitel „Lucy by the Sea“ deutet darauf hin: Dies ist der vierte Teil der Lucy-Barton-Serie, in der die Schriftstellerin aus Maine über eine Schriftstellerin aus Maine schreibt. Doch auch, wenn Strout nicht direkt von Lucy Barton berichtet, erkennt man sie und das Personal anderer Romane in ihrem Erzählkosmos wieder. So taucht hier der liebenswürdige Anwalt Bob Burgess auf, dem Strout 2013 den Roman „Das Leben, natürlich“ widmete.
Und glücklicherweise gibt auch Olive Kitteridge ein Lebenszeichen: Für das Porträt der nicht besonders liebenswürdigen pensionierten Mathematiklehrerin erhielt Strout den Pulitzer-Preis (auf Deutsch, wie alle Strout-Romane ein Allerweltstitel-Titel: „Mit Blick aufs Meer“. ) Nun also die Pandemie und was sie in den Menschen hervorgebracht hat. Lucys Ex-Mann William, ein Naturwissenschafter, erkennt früh die Bedrohung der Seuche und bittet Lucy, Brooklyn zu verlassen und mit ihm nach Maine zu gehen. So wie die Niederösterreicher damals nicht neugierig auf die Wiener waren, haben auch die Dorfbewohner in Maine nicht auf die New Yorker gewartet – die Großkopferten, die Demokraten, die Maskenträger. Alle gesellschaftlichen Spannungen, die sich bereits abgezeichnet hatten, entladen sich.
Strout versucht, alle Beteiligten zu verstehen. Und strauchelt. „Welche Gnade, dass wir nicht wissen, was uns im Leben erwartet.“ Und doch lohnt es sich, dieses Leben zu leben: auf diesem „schönen, schrecklichen Stern, unserer Erde.“
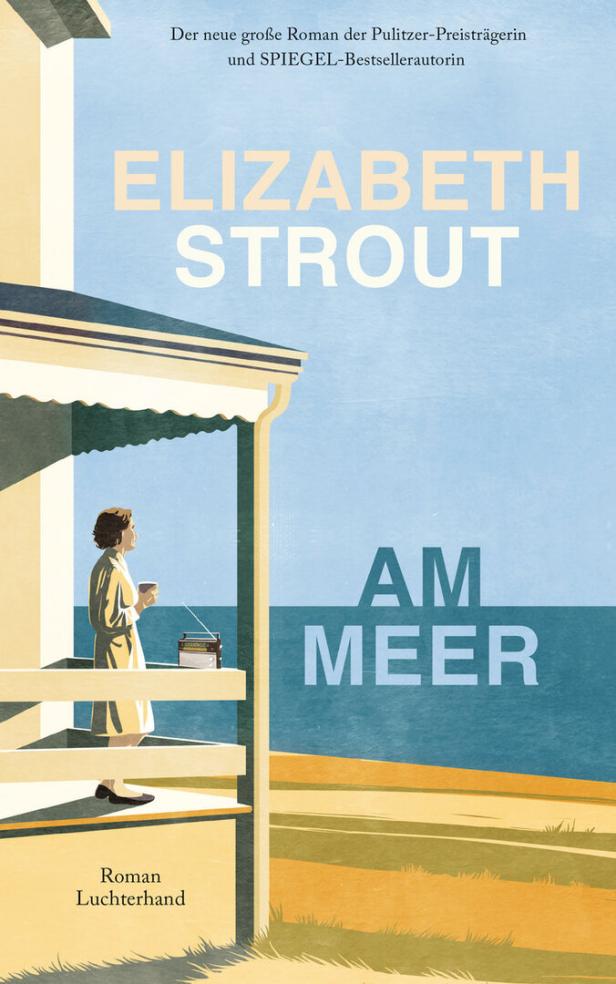
Elizabeth Strout: „Am Meer“.
Ü: Sabine Roth
Luchterhand
287 S. 25,50€

