Daniel Kehlmann über einen Meister der Verdrängung

Auch nach dem Krieg waren sie gut beschäftigte Publikumslieblinge. Nehmen wir Heinz Rühmann. Verheiratete seine jüdische Frau mit einem anderen, um unter den Nazis unbehelligt weiterfilmen zu können. Oder Franz Antel – schon lange vor dem Anschluss Österreichs NSDAP-Mitglied. Bernhard Minetti? In der Nazizeit gut beschäftigter Schauspielstar. In Daniel Kehlmanns Roman wird er außerdem von Kollgen verdächtigt, an die Gestapo zu berichten. (Und er outriert fürchterlich.) Heinz Conrads? Nein, über ihn ist nichts Einschlägiges bekannt. Doch die fulminante Auftaktszene von Kehlmanns neuem Roman zeigt ihn als Schleimer vor der Kamera und als ordinäres Scheusal dahinter. „Pappen halten“ und „schleich di“ bekommen Mitarbeiter zu hören.
Daniel Kehlmann eröffnet seinen Roman „Lichtspiel“ nicht zufällig mit Heinz Conrads, für eine bestimmte Generation Symbol der Sehnsucht nach einer guten alten Zeit: Tun wir so, als hätte es in Österreich keine Nazis gegeben, als hätte ihnen niemand zugejubelt.
Ein Spezialist der Verdrängung, einer, der glaubte, sich mit allen arrangieren zu können, muss auch der Filmemacher Georg Wilhelm Pabst, um den es in diesem Roman geht, gewesen sein. Geboren 1885 in Böhmen, stammte Pabst aus gutbürgerlichem Haus und entschloss sich zum Entsetzen seiner Eltern, Schauspieler zu werden. Sein Regiedebüt gab er 1922, drei Jahre später drehte er den sozialkritischen Stummfilm „Die freudlose Gasse“ mit Greta Garbo und Asta Nielsen. Für den erotischen Stummfilm „Die Büchse der Pandora“ nach Frank Wedekind engagierte er die Amerikanerin Louise Brooks, ebenfalls ein späterer Weltstar (und, zumindest im Roman, für immer Pabsts Traumwesen).

G.W. Pabst, hier 1954 bei Dreharbeiten, starb 1967. In Wien-Favoriten heißt eine Gasse nach ihm
Beide, Brooks wie Garbo, trifft der Regisseur in Kehlmanns Roman in Hollywood wieder, wo er nach der Machtergreifung der Nazis in Europa Fuß zu fassen versucht. Keine will mehr mit ihm drehen, nachdem er in Folge eines Misserfolgs als Kassengift gilt. 1936 kehrt Pabst nach Europa zurück, zunächst nach Frankreich. 1939 wird er in Österreich, wo er seine Mutter besucht, vom Beginn des Zweiten Weltkrieges überrascht. Hier wird er sich bald an das Regime anpassen und nun Filme für Nazi-Deutschland drehen. Stets vermeintlich „unpolitisch“ und allein nach künstlerischer Meisterschaft strebend. Was nicht so einfach ist, wenn man den miesen Roman eines Nazimitläufers verfilmen muss. „Der Fall Molander“ nach Alfred Karrasch blieb unvollendet, das Material ist angeblich verschollen. Spätestens hier zeigt sich, dass Pabsts Plan nicht aufgeht: Er beherrscht zwar den Hitlergruß, die Nazis halten ihn aber immer noch für einen Linken (wahlweise Kommunisten oder „Judenfreund“) – und sein künstlerischer Ruf ist weitgehend ruiniert. Nach dem Krieg wird Pabst weiterfilmen, aber künstlerisch nicht mehr an seine früheren Werke anschließen können.
Offen bleibt, wer der Mann wirklich war. Das weiß einmal seine Frau Gertrude, die ihm irgendwann unterstellt, bereits in Hollywood mit einem Vertreter des Propagandaministeriums gemeinsame Sache gemacht zu haben. Auch Kehlmann beantwortet diese Frage nicht. An keiner Stelle verurteilt er seinen Protagonisten.
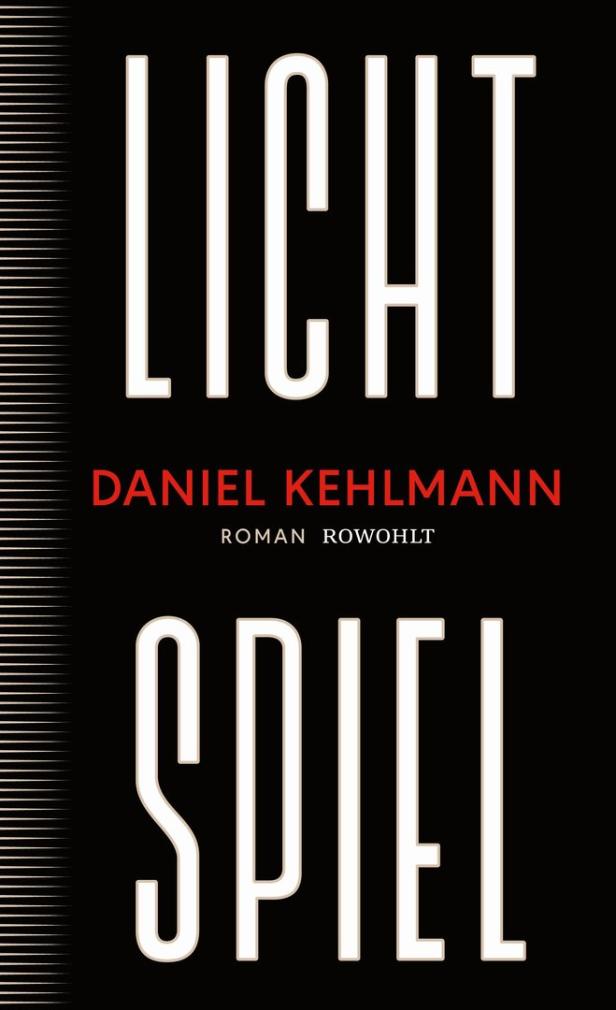
Daniel
Kehlmann:
„Lichtspiel“
Rowohlt.
480 Seiten.
26,80 Euro
KURIER-Wertung: 5 von 5 Sternen
Dreiturm statt Fünfturm
Wie Schlaglichter nimmt er sich einzelne Momente in Pabsts Leben vor und hält sich dabei weitgehend an biografische Eckdaten, nimmt sich aber auch künstlerische Freiheiten – so heißt etwa Pabsts Schloss im steirischen Tillmitsch hier Dreiturm, tatsächlich aber Fünfturm. Vor allem aber hat Kehlmann natürlich viele Begegnungen und Dialoge (fantastisch) erfunden. Viele davon könnten allerdings genau so verlaufen sein. Etwa jene mit Leni Riefenstahl, mit der Pabst mehrfach arbeitete. Die Regisseurin pathetischer Nazi-Filme wird als untalentiert und einfältig dargestellt. Englisch kann sie auch nicht. Kehlmann schaut ihr, aber auch anderen genau aufs Maul – was, etwa bei steirischen Nazi-Hausmeistern, auch ziemlich komisch ist.
Daniel Kehlmanns Roman ist dicht, perspektivenreich und klug. Er erzählt die Konsequenz von Kompromissen zu Ende. G.W. Pabst zahlt einen Preis für seine Anpassungsfähigkeit. Er wurschtelt irgendwie weiter. Andere zahlten gar keinen Preis.

