Wenn Menschen ihre Körper spenden
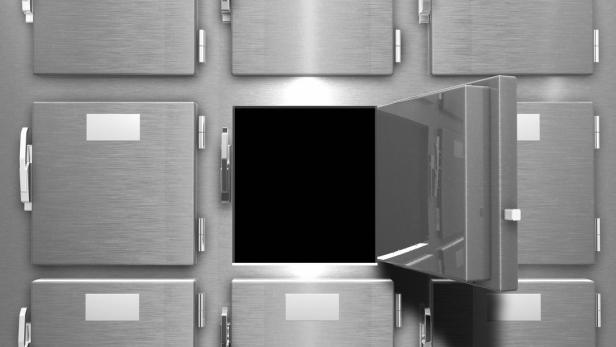
Bildung: Studierende lernen in Sezierkursen dank der Körperspenden den menschlichen Körper real kennen
Wer gerne am Zentralfriedhof spazieren geht, hat sie vielleicht schon gesehen.
Zwei Anatomie-Gedenkstätten gibt es dort (Gruppe 12 F und 26) für die Menschen, die ihren Körper der Medizin gespendet haben. Wie viele es insgesamt sind, kann man nicht sagen, heißt es vonseiten des Friedhofs. Aber alleine in den vergangenen zehn Jahren wurden an der 2009 neu gestalteten Gedenkstätte 11.109 Menschen beigesetzt.

Am Zentralfriedhof gibt es zwei Gedenkstätten. Seit 1975 wird in der Gruppe 26 (Bild) beigesetzt. Davor wurde auf dem Ort der Gruppe 12 beigesetzt.
Gruppe 26: Architekt Christof Riccabona hat für den Platz einen achteckigen Bereich aus abgestaffelt hohen Mauern entworfen. Angehörige können eine Namenstafel für 10 Jahre (210 Euro) anbringen lassen.
Ihre Asche wird lose in die Grabanlage eingestreut. Die Verwandten sind bei der Einstreuung nicht dabei, denn meist passiert diese erst zwei bis drei Jahre nach dem Tod.
Totengedenken
Umso wichtiger sind die jährlich stattfindenden Gedenkveranstaltungen, wie die in der Votivkirche: Am Donnerstagabend war der Andrang besonders groß, denn nach zwei Jahren Pandemie konnte der ökumenische Gottesdienst erstmals wieder „live“ stattfinden.
Vor Ort waren Angehörige, aber auch Studierende. Es wurde gebetet, an die Verstorbenen erinnert und in ein Totenbuch geschrieben.

Beim ökumenischen Wortgottesdienst in der Votivkirche am Donnerstagabend wurde den Verstorbenen gedacht, die ihren Körper an die Wissenschaft spendeten.
„Für viele ist es eine der wenigen Möglichkeiten, Abschied zu nehmen“, sagt Pater Simon De Keukelaere, katholischer Universitätsseelsorger, der den Gottesdienst gemeinsam mit Katharina Payk, evangelische Pfarrerin der Universität, vorstand. Angehörige können nämlich nicht rückgängig machen, was ihre Verwandten über ihren Körper beschlossen haben.
1.000 Körperspenden
gibt es jährlich an der MedUni Wien.Wer das will, muss zu Lebzeiten einen Vertrag abschließen. Angehörige können nicht widersprechen
990Euro
beträgt der Kostenbeitrag für die Körperspende, bis ins Jahr 2004 war es kostenlos.
„Ich würde meinen Körper nur spenden, wenn es für meine Angehörige in Ordnung wäre“, sagt dazu Wolfgang Weninger. Er ist Leiter der Anatomischen Abteilung an der medizinischen Universität im 9. Bezirk. Immer wieder käme es vor, dass Angehörige im Zentrum für Anatomie und Zellbiologie anrufen und darum bitten, den Körper freizugeben. „Für viele ist das nicht leicht“, meint er. „Aber die Menschen schließen einen Vertrag ab, um der Lehre zur Verfügung zu stehen, sie erhalten einen Körperspender-Ausweis, weil sie sich dazu entschließen“, sagt er.

Leiter Anatomische Abteilung (MedUni): Wolfgang Weninger
Auflösen könne den Vertrag nur die Person selbst. Nach dem Tod wird der Körper an die MedUni überstellt. Die rund 1.000 Körper im Jahr werden für die Lehre und Forschung fixiert, also mit chemischen Substanzen haltbar gemacht. Dabei wird das Blut durch eine Fixierlösung ersetzt. Keime werden abgetötet, der Zerfall wird gestoppt. „Masken musste man nur wegen Corona tragen, Bakterien werden so eliminiert“, meint Weninger.
Die Sektion an sich dauert ein Jahr. Egal, welche ärztliche Ausbildung man wählt, jeder müsse Hand anlegen. „Wir achten auf Pietät und ethische Korrektheit“, sagt Weninger. Ansonsten müssten Studenten den Kurs wiederholen.
1404 fand die erste Leichenöffnung im Spital der Brüder zum Hl. Geist in Wien (heutiger Resselpark) – dem Verbot des Wiener Dompropstes zum Trotz – statt. Hintergrund der Auseinandersetzung war die Sorge um die Unversehrtheit des menschlichen Körpers. Anfang des 15. Jahrhunderts hatte man theologisch noch Schwierigkeiten, die Auferstehung des Leibes mit einer Leichenöffnung in Einklang zu bringen. Die Brüder des Hl. Geistes, die sich hauptsächlich der Krankenpflege widmeten, nutzten ihre rechtliche Unabhängigkeit vom Wiener Domkapitel, um dennoch der Wissenschaft Raum zu geben. Gut 300 Jahre später ermöglichten die Jesuiten 1749 mit dem „teatrum anatomicum“ an der Universität Wien (heute Akademie der Wissenschaften) den Beginn eines international renommierten anatomischen Wissenschaftsbetriebes in Wien.
Gearbeitet wird mit Skalpell, Schere, Pinzette und Säge. Haut, Unterhaut, Fettgewebe, Faszien, Muskulatur bis zum Knochen: „Schicht für Schicht geht man durch den Körper und bekommt ein dreidimensionales Verständnis“, sagt er. Elektronische Geräte seien im Seziersaal verboten. Die jungen Ärzte seien meist im zweiten Studienjahr und besuchen den Kurs einmal wöchentlich. Am Institut gibt es sechs Seziersäle mit jeweils 20 Tischen.
Nachfrage steigt
Dass die Nachfrage steigt, merkt man am steigenden Angebot. Die MedUni war lange die einzige Uni, die Körperspenden aus Wien, Niederösterreich und Burgenland annahm. Seit 2018 nimmt die Karl-Landsteiner-Privatuniversität in Krems Körperspenden (1.450 Euro in NÖ, 1.650 Euro in OÖ) an. Sie bieten auch an, die Urne an Angehörige nach der Forschung zur Beisetzung zu übergeben. (Auf Anfrage)
Laut der Kremser Uni spenden die Menschen, weil sie etwas für die ärztliche Ausbildung tun wollen, aber auch aus finanziellen Gründen. Eine Bestattung koste mehrere Tausend Euro. Die private Sigmund Freud Uni präsentiert übrigens im Frühjahr ein neues Körperspender-Programm, gemeinsam mit den Friedhöfen.



Kommentare