Sexsucht und Spielsucht nehmen zu
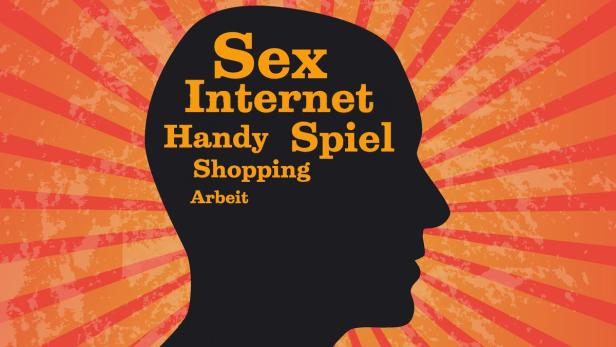
Der 22-jährige Medizinstudent zog sich immer mehr zurück, vernachlässigte sein Studium enorm und verließ kaum noch das Haus. Nur im Netz war er praktisch rund um die Uhr präsent – auf Pornoseiten, und die Impulse mussten mit der Zeit immer intensiver sein. Irgendwann brachten nicht einmal mehr die härtesten Seiten die erhoffte Befriedigung.
Die Psychologin Christina Raviola hat immer häufiger mit derartigen Problemen zu tun. Das berichtete sie vergangenes Wochenende beim diesjährigen interdisziplinären Suchtsymposium am Grundlsee. Bei der Expertentagung wurden u. a. die sogenannten stoffungebundenen Süchten beleuchtet. Nicht eine Substanz sorgt für die Gefährdung, sondern exzessives Aktivitäten. Das Suchtverhalten kann neben Sex zum Beispiel auch Sport, Einkaufen, Internet oder Glücksspiel umfassen.
Heterogene Störung mit steigendem Leidensdruck
Was die Sexsucht betrifft, spricht Raviola – sie leitet das Institut für klinische Sexualpsychologie in Wien – lieber von Hypersexualität. "Sexsucht ist nicht der ideale Begriff, es handelt sich um ein heterogenes Störungsbild." In der Regel gehe Hypersexualität mit anderen Störungen einher. Das könne Spiel- oder Internetsucht oder auch eine Neigung zur Substanzabhängigkeit sein.
Betroffen sind bis zu sechs Prozent der Bevölkerung. "Der Altersgipfel liegt zwischen 20 und 40 Jahren", sagt Raviola. Vor allem seien Männer betroffen. Dazu kommt, dass die leichte Verfügbarkeit von Pornos Jugendliche sehr früh in Kontakt mit Sex bringt. Raviola hat bereits Jugendliche in Therapie.
Doch nicht jeder, der Pornos schaut oder viele Orgasmen zum Wohlbefinden braucht, ist sexsüchtig. "Bedeutend ist der Leidensdruck – und, dass keine Befriedigung erreicht wird. "Wer mehrmals pro Tag masturbiert und ständig auf der Suche nach sexuellen Reizen ist, ist schon mitten drin im Suchtverhalten." Bestimmte Parameter müssen erfüllt sein, etwa exzessiver Zeitaufwand, partnerschaftliche Probleme oder Schwierigkeiten bei Kontaktanbahnungen.
Auslöser sind vielfältig
Die Auslöser sind vielfältig. Fest steht, dass etwa Stressverarbeitung oder Risikoverhalten ebenso eine Rolle spielen, wie Hormone und neurobiologische Strukturen im Belohnungssystem. "Hypersexualität muss in eine umfassende psychologische und psychiatrische Abklärung eingebunden sein und darf nie das alleinige Diagnose-Kriterium sein."
Von Glücksspielsucht sind meistens Männer betroffen
Während immer öfter auch Frauen unter ihrem ausgeprägt-exzessiven Sexualverhalten leiden, bleibt das pathologische Glücksspiel zu 90 Prozent eine Männerdomäne. Das geht aus Untersuchungen des Münchener Instituts für Therapieforschung (IFT) hervor. "Leider fehlen solche Untersuchungen in Österreich", beklagt Suchtexpertin Univ.-Prof. Gabriele Fischer von der MedUni Wien, die das Symposium initiierte.
Angst vor Stigmatisierung
Von Glücksspiel als krankhafte Störung ist laut IFT-Leiter Ludwig Kraus rund ein Prozent der Bevölkerung betroffen. Doch die Dunkelziffer ist hoch. Während beim klassischen Glücksspiel eher Männer mit höherem Einkommen süchtig werden, sind Internetspieler jünger und haben weniger psychische Probleme. "In die Beratungen kommen aber immer nur die schweren Fälle", erklärt Kraus. Warum das so ist, hat viel mit bekannten Faktoren aus der Suchtbehandlung zu tun. "Da kennen wir etwa die Verleugnung von Problemen." Dazu kommen beim Glücksspiel ein hohes Schamgefühl und Angst vor Stigmatisierung.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Sucht- und Schmerzexperten wird aber immer wichtiger. „Es gibt auf beiden Seiten viele tolle Therapeuten. Aber die Verbindung funktioniert noch nicht so, wie es wünschenswert wäre.“ So erklärt Univ.-Prof. Gabriele Fischer, MedUni Wien, warum beim diesjährigen Symposium zur Suchterkrankung dieser Schwerpunkt gewählt wurde. „Das Thema wird immer relevanter, in beiden Bereichen gibt es häufig falsche Dosierungen.“ Das betreffe Senioren in Pflegeheimen ebenso wie Opiatabhängige in Substitutionstherapie, für deren Schmerzverarbeitung das Fachwissen fehlt.
Opiathältige Medikamente bei chronischem Schmerz
In Österreich leiden laut Schätzungen 1,5 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Opiathältige Medikamente stehen für chronische Schmerzpatienten häufig an der Tagesordnung. Viele haben dabei Angst, in eine Sucht zu schlittern. Denn diese Medikamente haben schließlich auch ein Abhängigkeitspotenzial. „Mit Dauerschmerzen greift man gerne danach, denn sie helfen ja auch“, beschrieb das Schmerzpatientin Barbara Van der Goes bei einer Diskussionsrunde. „Aber es wird einem nicht aufgezeigt, wie man wieder herauskommt.“ Sie fordert daher, dass die Möglichkeiten moderner Schmerztherapien besser ausgeschöpft werden. So sollten die Angebote multimodaler Schmerztherapie verbessert werden und Alternativen zu Opiaten wie etwa medizinische Cannabinoide ermöglicht werden. „Diese sind eine Chance, Schmerzgrenzen anders zu setzen.“
Kommentare