Geheimnis der Langlebigkeit: Was wir von Ordensleuten lernen können

Die brasilianische Ordensfrau Inah Canabarro Lucas galt vom 29. Dezember 2024 bis zu ihrem Tod am 30. April 2025 als ältester lebender Mensch der Welt. Sie wurde 116 Jahre alt.
Sie gilt derzeit als weltweit ältester lebender Mensch: Die 116-jährige brasilianische Ordensfrau Inah Canabarro Lucas. Von April 2022 bis Jänner 2023 war bereits einmal eine Ordensfrau der älteste lebende Mensch, die Französin Lucile Randon, sie wurde 118 Jahre alt. Und die von Marc Luy, Direktor des Instituts für Demografie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, gegründete Deutsch-Österreichische „Klosterstudie“ zeigte: Ordensmänner leben im Schnitt fünf Jahre länger als Männer insgesamt.
Doch was trägt Ordensleute bis ins hohe Alter? Und was können Menschen außerhalb von Klöstern von ihnen lernen?
Die Soziologin und Theologin Ruth Mächler hat für eine Studie mit 21 Frauen und Männern – Sacré-Coeur-Schwestern und Jesuitenpatres aus Deutschland und Österreich – im Alter zwischen 80 und 98 Jahren Tiefeninterviews durchgeführt und jetzt ein Buch darüber veröffentlicht.
KURIER: Nach Ihren Gesprächen mit über 80-jährigen Ordensleuten: Wie erklären Sie sich, dass diese häufig so alt werden?
Ruth Mächler: Es sind sicher mehrere Faktoren, die auch in den Gesprächen immer wieder genannt wurden: Eine gewisse Regelmäßigkeit des Tagesablaufs sowie ein gemeinsames Ziel im Leben. Dadurch wird auch die Arbeit – sei es in einer Schule, in der Seelsorge oder woanders – als sinnstiftend empfunden. So gut wie alle über 80-Jährigen waren – angepasst an ihre jeweiligen Kräfte – noch in irgendeiner Form aktiv.
Ein Kennzeichen war auch eine hohe Flexibilität im gesamten Leben: Viele mussten bereit sein, immer wieder neue Aufgaben zu übernehmen, Neues zu lernen und Fortbildungen zu absolvieren, auch den Wohnort zu wechseln. Das hält offenbar Körper und Geist fit und jung.

Die Soziologin und Theologin Dr. Ruth Mächler hat 21 über 80-jährige Sacré-Coeur -Schwestern und Jesuiten über das Altwerden interviewt - und dabei auch vieles für das eigene Leben mitgenommen.
In einem Orden gibt es ja keinen echten Ruhestand?
Genau, und keiner meiner Befragten hat das kritisiert oder darüber geklagt. Wenn der Satz fiel, "Wir Ordensleute gehen ja nicht in Pension", dann war das in meiner Wahrnehmung nie negativ, sondern immer positiv gemeint. Alle haben mit Freude und mit einem gewissen Stolz erzählt, was sie bis ins hohe Alter gearbeitet und getan haben – beziehungsweise noch immer tun. Etwa sich um andere im Orden zu kümmern, solange ihnen das körperlich möglich ist, oder in kleinen Hausgottesdiensten zu predigen und in der Seelsorge tätig zu sein.
Und die letzte Aufgabe, die auch mit großen körperlichen Einschränkungen möglich ist, ist bei vielen für andere zu beten. Eine Ordensschwester hat mir gesagt: "Wenn ich für andere bete, und ihnen das sage oder schreibe, dann freuen sich die Leute."
Zur Person
Dr. rer. pol. Ruth Mächler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Spiritual Care und psychosomatische Gesundheit am Klinikum der Technischen Universität München. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte sind existenzielle und spirituelle Bedürfnisse kranker Menschen. Nähere Informationen: www. spiritualcare.de
Buchtipp
Ruth Mächler: „Freiheit und Vertrauen – Von alten Ordensleuten für das Leben lernen“, Patmos, 191 Seiten, 24 Euro.
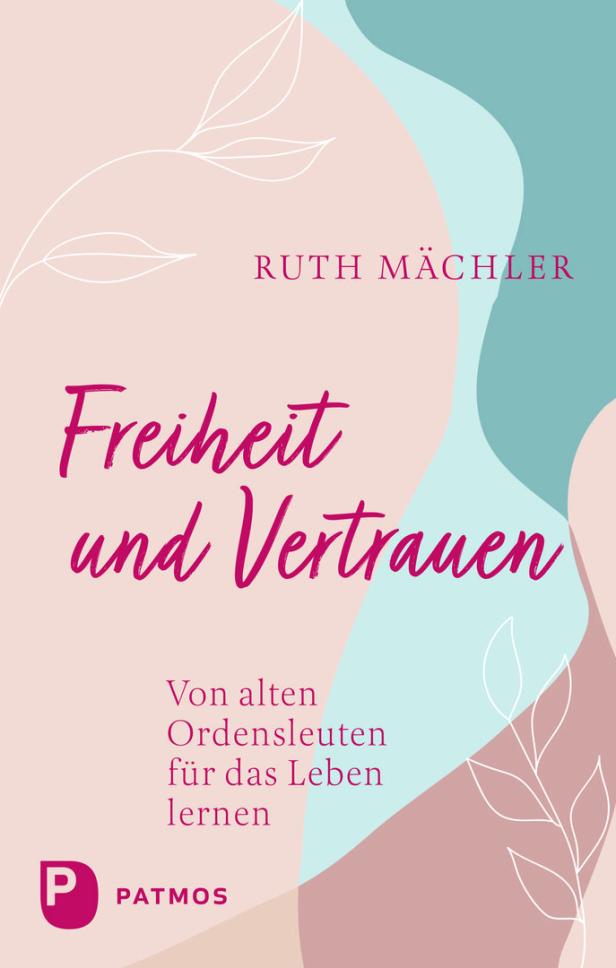
Das Cover des neuen Buches.
Man könnte also von einer optimalen Work-Life-Balance sprechen?
Ich würde es als Work-Life-Spirit-Balance bezeichnen: Die Arbeit bis ins hohe Alter ist von einer inneren Überzeugung der Sinnhaftigkeit getragen, dem Wunsch, etwas an andere weiterzugeben – viele bleiben mit jüngeren Menschen bis ins hohe Alter im Gespräch. Und dadurch streben sie auch nicht danach, diese Arbeit möglichst rasch zu beenden. Realistischerweise ist das im allgemeinen Berufsleben nicht immer der Fall – aber man kann sich zum Beispiel ehrenamtlich engagieren und damit einer sinnvollen Aufgabe nachgehen, die einem dann vielleicht auch über den Pensionsantritt hinaus bleibt.
Haben Sie aus den Gesprächen auch für Ihr Leben etwas mitgenommen?
Ich bin in einige sehr kleine, dunkle Pflegeheimzimmer gekommen und bin dort trotz ihrer körperlichen Einschränkungen auf sehr frohe, dankbare und auch zufriedene Menschen gestoßen. Das hat mich doch sehr auch über meine eigenen Ansprüche nachdenken lassen, was ich im Leben wirklich brauche und mir wichtig ist.
Und etwas anderes auch: Viele haben mit Stolz erzählt, in bestimmten schwierigen Situationen durchgehalten zu haben. Aber nicht im negativen Sinn des Ertragens und Erduldens mit zusammengebissenen Zähnen, sondern nach einem intensiven Hinterfragen, oft auch mit professioneller Hilfe: War meine Entscheidung damals für das Ordensleben die richtige? Haben sich meine Werte von damals geändert? Also die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen – und erst dann zu entscheiden. Da haben viele rückblickend gemeint, sie waren froh, das intensiv getan zu haben, die Krise gemeistert und nicht vorschnell alles hingeschmissen zu haben.
Das gilt ja für eine Partnerschaft oder einen beruflichen Weg generell auch – bei Krisen zuerst innezuhalten und nach innen und außen zu hören.
Was können auch junge Menschen von Ordensleuten lernen?
In den Gesprächen haben sie mir öfter als Rat für junge Menschen genau das mitgegeben – eben dieses Durchhalten in Krisen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen und erst danach eine Entscheidung in eine oder andere Richtung zu treffen. Das ist auch ein Baustein für ein zufriedenes Altwerden. Und auch darauf zu vertrauen, dass das Leben einen guten Urgrund hat, dass es auf etwas Tieferem gründet und einen Sinn hat.
Für die Ordensleute ist die Basis ihres Vertrauens ihr Glaube an Gott, aber es muss nicht der Glaube sein: Es können auch andere Kraftquellen sein, etwas, das Hoffnung gibt, etwa das Gute im Menschsein, oder die Kraft der Natur. Aber es ist wichtig, sich nicht in den Ängsten zu verlieren, die gerade derzeit so zunehmen. Von den Ordensleuten kann man lernen, Vertrauen zu haben, bewusst daran zu arbeiten, es zu entwickeln und zu pflegen.
Der Titel Ihres Buches lautet „Freiheit und Vertrauen“. Das Vertrauen haben Sie erklärt – aber wieso Freiheit?
Auf den ersten Blick verbinden wir doch Ordensleben mit Unfreiheit – mit Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam. Und tatsächlich gibt man mit der Entscheidung für einen Orden viele Ansprüche auf – etwa jenen auf materiellen Besitz. Trotzdem sind viele dieser Leute in gewisser Weise reich, zufrieden und auch frei.
Mich hat überrascht, wie viel innere Freiheit Menschen in solchen Strukturen gewinnen können – und wie authentisch und selbstbewusst sie ihren Weg gehen. Auch davon können wir lernen – verschiedene Dinge nicht so wichtig zu nehmen, loslassen zu können und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Kommentare