Seltene Form von Anämie: Wenn Kinder kein Blut produzieren

Josefine und Luis mit ihren Eltern bei einer Benefiz-Veranstaltung im Weltmuseum in Wien, die von Harald Krassnitzer (re.) moderiert wurde.
„Es geht Josefine, 10, und Luis, 11, den Umständen entsprechend gut“, sagt ihr Vater Boris Marte. „Aber das heißt nicht, dass alles in Ordnung ist: Die Kinder benötigen alle drei Wochen eine Bluttransfusion. Und dadurch gibt es praktisch kein normales Leben für die Kinder.“
Josefine und Luis sind an der Diamond-Blackfan-Anämie (DBA) erkrankt, einer angeborenen Form einer schweren chronischen Blutarmut. Sie beruht auf einem noch nicht genau geklärten angeborenen Defekt, der die Bildung der roten Blutzellen im Knochenmark beeinträchtigt.
„Medizinisch gesehen sind diese Bluttransfusionen vergleichbar mit einer Transplantation“, erklärt Marte. Die Kinder liegen fünf bis sechs Stunden zur Beobachtung im Spital. Am Tag vor jeder Transfusion muss im Spital eine Kreuzprobe durchgeführt werden: Auch da müssen sie gestochen werden, um kontrollieren zu können, ob das Spenderblut zu ihrem Blut passt.“

Boris Marte: "Wegen der regelmäßigen Bluttransfusionen gibt es praktisch kein normales Leben für unsere Kinder."
Hinzu kommt: Die häufigen Bluttransfusionen „führen zu einem sehr, sehr hohen Eisengehalt im Körper“. Die Kinder müssen starke Medikamente nehmen, die Nebenwirkungen haben können. Zu hohe Eisenwerte können Organe, etwa Herz, Leber oder Niere, schädigen.
Marianne und Boris Marte haben 2016 mit der Hilfe prominenter Wissenschafter ein großes Forschungsprojekt initiiert. „Das Ziel ist, die Ursachen herauszufinden, warum unsere und viele Tausende Kinder auf der Welt nicht imstande sind, Blut zu produzieren. Das wird auch ganz wesentliche Erkenntnisse für andere Krankheiten, etwa Leukämie, bringen. Wenn wir den genauen Mechanismus kennen, kann hoffentlich auch eine gezielte Therapie entwickelt werden.“
Unterstützer waren (und sind) u. a. Josef Penninger, der Gründungsdirektor des IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie der Akademie der Wissenschaften), der Biochemiker Javier Martinez von der MedUni Wien an den Max Perutz Labs und das St. Anna Kinderspital.
„Wir machen es so wie unser Nobelpreisträger Anton Zeilinger“, sagt Marte: „Auch er hat mit Grundlagenforschung angefangen und hatte keine Ahnung, wohin ihn die Reise führt.“
KURIER Talk mit Boris Marte
Im Knochenmark entwickeln sich alle Blutzellen aus gemeinsamen Vorläuferzellen, den blutbildenden Stammzellen. Aber auf dem Entwicklungsweg von der Stammzelle zum roten Blutkörperchen schleicht sich – aufgrund einer genetischen Mutation – bei DBA-Patienten ein Fehler ein. „Es fehlt ihnen etwas für die Blutbildung“, erklärt Martinez.
Drei Ansätze
Daran wird konkret geforscht:
Ansatz eins: Bekannt ist bereits ein Protein, das bei DBA krankhaft verändert ist. „Wir haben herausgefunden, dass diese toxische Version zwei andere Proteine bildlich gesprochen umarmt und eventuell blockiert. Wir vermuten, dass diese aber für den Prozess der Entwicklung der Blutzellen wichtig sind. Durch die Blockade würden sie ihre Funktion verlieren“, sagt Martinez.

Biochemiker Javier Martinez: "Proteine sind blockiert."
Ansatz zwei: In einem zweiten Projekt, ebenfalls an den Max Perutz Labors, werden Stammzellen der Kinder und der gesunden Mutter im Labor durch verschiedene Wachstumsfaktoren angeregt, sich in Richtung roter Blutkörperchen zu entwickeln. Bei den Zellen der Mutter gelingt dies gut, bei den Zellen der Kinder aber – wegen des Defekts – nicht. Mit diesem Test kann die Wirkung potenzieller Therapeutika überprüft werden, von denen eines, das derzeit in den Max Perutz Labs entwickelt wird, bereits eine positive Reaktion in Patientenzellen zeigt. Dies könnte ein Ansatz für ein Medikament sein.
Ansatz drei: Am IMBA ist es Jürgen Knoblich 2013 erstmals gelungen, aus menschlichen Stammzellen „Gehirn-Organoide“ herzustellen – kleine Modellorgane für die Grundlagenforschung. Jetzt arbeitet Kirill Salewskij an Knochenmark-Organoiden, die aus Stammzellen der Kinder und auch der Eltern entwickelt werden. „An diesen könnte dann zum Beispiel untersucht werden, wie sich verschiedene Medikamente auf die Zellentwicklung auswirken.“.
Marianne und Boris Marte sind zuversichtlich: „Es gibt bereits erste vielversprechende Erkenntnisse. Wenn wir ein bisschen Glück haben, könnte ausgehend von Wien weltweit Menschen geholfen werden, diese Krankheit zu überwinden.“
Spendensumme
Marianne und Boris Marte haben sich verpflichtet, jährlich zirka 200.000 Euro durch Spenden aufzubringen, um die DBA-Forschung zu finanzieren. Bisher konnten mehr als 800.000 Euro gesammelt werden.
Infos: https://dbaexperiment.org
Spendenkonto
Philanthropie Österreich
Capital Bank – GRAWE Gruppe AG
IBAN: AT45 1960 0000 1505 9413
BIC: RSBUAT2K
Verwendungszweck: Diamond-Blackfan-Anämie.
Die Spenden sind steuerlich absetzbar
5-7 Kinder
kommen innerhalb von zehn Jahren in Österreich mit DBA auf die Welt

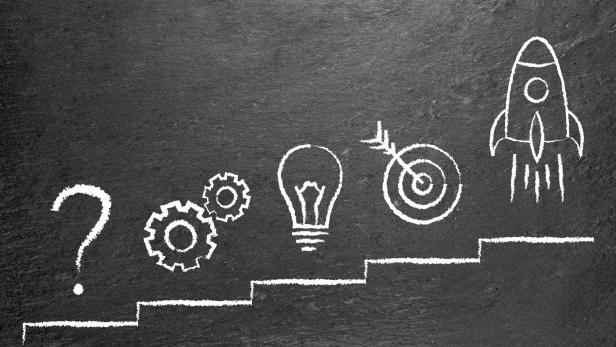
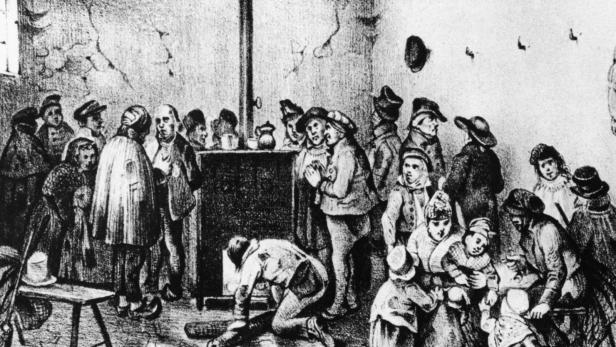

Kommentare