Isoliert in der Pandemie: "Einsamkeit hat viele Gesichter"

Florian P. ist im ersten Semester seines Studiums, seit dem Sommer lebt der Tiroler allein in einer kleinen Studentenwohnung in Wien (*Name und Details zur Anonymisierung geändert). Die Stadt ist ihm noch nicht vertraut, Corona-bedingt hatte er bisher nur selten die Möglichkeit, seine Kommilitonen kennenzulernen oder abseits vom Studium Kontakte zu knüpfen. Seit einigen Wochen schläft er nun schlecht, hat kaum Appetit, ist immer öfter gereizt.
Nadine M. ist alleinerziehende Mutter. Zusammen mit ihren beiden schulpflichtigen Kindern lebt sie in einem Haus am Land (*Name und Details zur Anonymisierung geändert). Homeoffice und Distance Learning sind für die alleinstehende Frau inzwischen zur zermürbenden Doppelbelastung geworden, außerdem plagen die Familie Geldsorgen. Normalerweise geht Frau M. nach der Arbeit zur Zerstreuung gerne einem Hobby nach: dem Tanzen. Wegen Corona ist das momentan nicht möglich; die Partnersuche gestaltet sich schwierig.
"An diesen Geschichten sieht man sehr gut, dass Einsamkeit viele Gesichter hat", sagt Sonja Hörmanseder, Geschäftsfeldleiterin der Krisenhilfe Oberösterreich. Die Pandemie wirke seit März "wie ein Brandbeschleuniger auf die Vereinsamungsproblematik". Einsamkeit sollte man nicht mit Alleinsein gleichsetzen: "Es ist das Fehlen einer Vertrauensperson, zu der man eine gute Beziehung hat. Man kann auch einsam sein, wenn man in einer Partnerschaft lebt oder von vielen Menschen umgeben ist."
Verschärfter Trend
"Einsamkeit ist per se nichts Neues", weiß auch Günter Klug, Präsident von Pro mente austria und Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. "Wir befinden uns schon seit einiger Zeit in einem Zustand der extremen gesellschaftlichen Veränderung, die dazu beiträgt, dass Einsamkeit um sich greift."
Starke Umbrüche seien etwa im Bereich der Kommunikation, der Arbeitswelt und des Familiengefüges zu beobachten. "Das macht das Leben für viele zur Herausforderung, verursacht Überforderung und Kontrollverlust, was wiederum in sozialen Rückzug, Einsamkeitsgefühle und Isolation münden kann."
Langfristig kann das chronischen Stress bedingen, der den Körper in einen dauerhaften Aktivierungszustand versetzt, der schließlich Erschöpfung auslöst. Dauerhaft Gestresste haben ein höheres Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Innere Anspannung, Schlaflosigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten sind erste psychische Folgen von Stress.
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit je nach Region zwischen zehn (etwa im skandinavischen Raum) und 60 Prozent (etwa in Osteuropa) von Einsamkeit betroffen. Österreich liegt mit rund 15 bis 20 Prozent im unteren Drittel. "In der Pandemie beziehungsweise im ersten Lockdown ist dieser Wert auf 47 Prozent angewachsen", sagt Klug.
Insgesamt lastet die Pandemie schwerer auf den Schultern von psychisch vorbelasteten Menschen. Auch psychisch stabile Menschen können in eine Krise oder depressive Episoden schlittern. Inzwischen ist der Großteil der Bevölkerung aus der alltäglichen Stabilität gerutscht, die emotionalen Reserven sind vielfach aufgebracht, die verordnete Abkapselung hat Spuren hinterlassen.
Neben älteren Menschen, die keinen Familienbesuch empfangen können, erleben vor allem junge Erwachsene diese Zeit als bedrückend. "Die Kontaktbeschränkungen betreffen sie auf eine ganz andere Art", sagt Klug. So würden etwa Kinder mitten im sozialen Lernen von ihren Freunden abgeschnitten, Jugendliche in einer Phase des zwischenmenschlichen Ausprobierens gehandicapt. "Das könnte langfristige Folgen für den sozialen Umgang im Erwachsenenalter bedeuten."
In ihrer Arbeit beobachtet die Sonder- und Heilpädagogin, dass viele ältere Menschen teilweise besser mit dem Ausnahmezustand zurechtkommen: "Sie verfügen häufig über eine höhere Resilienz, weil sie schon durch viele Krisen gegangen sind und auf Strategien im Umgang zurückgreifen können. Sie haben üblicherweise etwas weniger Kontakte als jüngere Menschen, die sind dafür tragfähiger in schlechten Zeiten."
Wien: Psychotherapeutische Ambulanz, 01/710 57 64, Helpline Österreichischer PsychologInnen 01/504 8000
Burgenland: Institut für Psychotherapie im ländlichen Raum, 02682/24 690
Niederösterreich: Krisenhilfe Niederösterreich, 0800/20 20 16
Oberösterreich: Krisenhilfe Oberösterreich, 0732/2177
Salzburg: Ambulante Krisenintervention der Pro Mente Salzburg, 0662/433 351
Steiermark: Kriseninterventionsteam Steiermark, 0800/500 154
Tirol: Hotline des Psychosozialen Krisendienstes, 0800/400 120
Kärnten: Psychiatrischer Not- und Krisendienst für Kärnten, 0664/300 70 07
Vorarlberg: Sozialpsychiatrischer Dienst Bregenz, 050/411 690
Langfristig problematisch
Laut Klug sei eine Impfung zwar ein Ausweg aus der akuten Pandemie, "die psychosozialen Kollateralschäden werden aber erst Monate oder Jahre später ihre Wucht entfalten". Die Krise habe bestehende Baustellen in der psychosozialen Versorgung offengelegt. Von politischen Entscheidungsträgern fordert er ein verständliches Krisenmanagement, das die Basis für eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes einerseits und nachhaltige Konzepte zur psychosozialen Versorgung andererseits legt.
Für viele Jüngere sei die Einsamkeit eine neue Erfahrung, sagt Hörmanseder. Ein neuer Gemütszustand, der mit Scham verbunden und stigmatisiert ist. Auch Menschen, die mitten im Leben stehen, bei denen viele Dinge, die sie brauchen, um sich nicht einsam zu fühlen, weggebrochen sind, leiden.
Daraus ergebe sich auch eine Chance: "Einsamkeit ist vielen erst durch Corona ein Begriff geworden. Das könnte ein Weg sein, dass Einsamkeit ein nachvollziehbareres Thema in der Gesellschaft wird. Hoffen wir, dass davon etwas bleibt nach der Pandemie und Einsamkeit weniger aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt wird."
- Eine Umarmung ist durch soziale Medien nicht ersetzbar. Digitale Tools können aber als Notprogramm in herausfordernden Zeiten Kontakt und Lichtblicke ermöglichen.
- Um den Antrieb nicht zu verlieren, gilt es den Tag, so gut es geht, zu strukturieren. Auch wenn man im Homeoffice arbeitet oder derzeit keiner beruflichen Tätigkeit nachgeht.
- Körperliche Betätigung im Freien hilft.
- Bestehende Kontakte sollten gepflegt, alte reaktiviert werden – das gilt vor allem rund um die Tage um Weihnachten.
- Allgemein gilt: Sich selbst und anderen Gutes tun, über Sorgen und Ängste reden, um sich zu entlasten (mit Profis oder nahe stehenden Menschen) – und Hilfe annehmen.
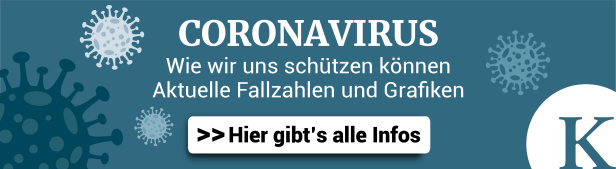




Kommentare