Schneekugeln, Magneten und Co.: Warum Souvenirs überall gleich aussehen

Sisi, Stephansdom, Riesenrad. Viktoria Petrics stapelt die Tassen mit den typischen Wien-Motiven akkurat übereinander. Dass sie alle 9,99 Euro kosten, ist kein Zufall. „Bis zu diesem Preis verkaufen wir alles sehr gut“, sagt die 44-jährige Filialleiterin mit den schwarzen, kurzen Haaren, den bunten Steinchen-Ohrringen und dem ungarischen Akzent.
In den Regalen des Souvenirgeschäfts auf der Wiener Mariahilfer Straße reihen sich Schneekugeln und Plastikfiguren neben Nackenhörnchen und Feuerzeugen. Kunden kommen, kaufen und gehen. Das Geschäft mit den Souvenirs läuft gut.
Steht man im Verkaufsraum, hat man das Gefühl eines Déjà-vus. Kennt man diese Souvenirs nicht auch aus London, Istanbul, New York? Nur eben mit dem Big Ben, der Hagia Sophia oder der Freiheitsstatue als Motiv? Ja, tut man.

Made in China
Denn die meisten Produkte kommen aus China, sogar aus denselben zwei Provinzen an der Küste – Zhejian und Fujian. Dort bestellen die Händler tonnenweise Souvenirs von der Stange, hergestellt in riesigen Fabriken mit automatisierten Produktionsabläufen. „Es ist in China viel einfacher, aus dem Katalog zu kaufen als elegante Designprodukte neu entwickeln zu lassen“, sagt Birgit Murr, österreichische Wirtschaftsdelegierte in China. Und natürlich billiger. Die Schablone ist dieselbe, das Motiv beliebig austauschbar.
Chinesische Exporte steigen nach wie vor, auch aufgrund gut funktionierender Logistik und top ausgebauter Infrastruktur. „In Vietnam wird zwar auch produziert. Aber die Mengen schafft nur China“, sagt Murr.
Eine „Made in China“-Kennzeichnung sucht man auf den Souvenirs vergeblich. „Die Händler sagen den Produzenten, dass das auf keinen Fall draufstehen soll.“ Der Schein des regionalen Kunsthandwerks soll wohl aufrechterhalten werden. Und in der EU ist das Kennzeichnen des Herstellungslands nicht verpflichtend.
Anfänge: Schon im 4. und 5. Jahrhundert nahmen Pilger zur Erinnerung auffällige Steine mit.
Se souvenir: Der Begriff aus dem Französischen – auf Deutsch „sich erinnern“ – bürgerte sich im 19. Jhd. ein.
80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher kaufen im Urlaub laut ÖAMTC-Reisemonitoring Souvenirs. Am beliebtesten sind Delikatessen, Magneten und Wahrzeichen als Miniatur.
Skurril: Eines der bizarrsten Mitbringsel stammt wohl aus Österreich. Zwei Unternehmer verkauften Hallstatt-Luft aus Dosen an asiatische Touristen.
Souvenir-Imperium
Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum sich der Krimskrams aus Hartplastik oft so ähnelt. Und der heißt Guntram Fessler. Der Österreicher hat in den vergangenen Jahrzehnten ein Souvenir-Imperium aufgebaut, mit rund 100 Souvenirgeschäften zählt er laut Handelsverband zu den größten Händlern Europas. Der Durchbruch gelang ihm mit dem Slogan „No Kangaroos in Austria“, seither tausendfach auf T-Shirts, Magneten und Tassen gedruckt.

Seiner Firma gehört auch das Geschäft in der Mariahilfer Straße, in dem Viktoria Petrics arbeitet. Produkte mit dem bekannten Spruch seien immer noch sehr gefragt, sagt sie. Am besten aber würden sich Magneten verkaufen – egal, ob mit Karlskirche, Schönbrunn oder „I love Vienna“-Schriftzug. Dementsprechend ist der Eingangsbereich vom Boden bis zur Decke mit den kleinen Kühlschrankapplikationen übersät, sie passen in jeden noch so vollen Koffer.
Petrics arbeitet seit 14 Jahren im Souvenirbusiness, sie mag den Job. Die gebürtige Ungarin war in Zell am See und Graz, bevor sie schließlich nach Wien gekommen ist. Was eigentlich die Mozartfiguren in den Regalen verloren haben? „Viele Touristen kommen nicht nach Salzburg, wollen aber trotzdem ein Souvenir von dort.“
Bei Mitbringsel geht es nämlich nicht vorrangig ums Erinnern an schöne Urlaubsmomente. Das sagt zumindest Clemens Schwender, deutscher Medienpsychologen und Kitschforscher. „Man selbst weiß ja, dass man beim Eiffelturm war. Es geht darum, anderen zu zeigen, dass man dort war.“

Hang zum Kitsch
Und es liegt an unserem Hang zum Kitsch. Wir kaufen ihn, weil er spontan ein gutes Gefühl hinterlasse. Diese Empfindung hätten wir schneller, als wir es erklären könnten. Es sei eine Art kindliche Entscheidung des Gefallens. Sie sei tief in uns verankert. „Wenn wir durch die Welt gehen, entscheiden wir ständig, was uns gefällt und was nicht“, sagt der Medienpsychologe. Der Beigeschmack des Minderwertigen entstehe erst durch die intellektuelle Beurteilung im Nachhinein. Und durch gesellschaftliche Normen, was Kitsch und was Hochkultur sei.
Obwohl Viktoria Petrics den ganzen Tag davon umgeben ist, kauft auch sie im Urlaub Souvenirs. Von der letzten Italien-Reise hat sie eine Tasche für die Schwiegermutter mitgenommen. Und für sich einen „I love Rome“-Magneten – made in China.
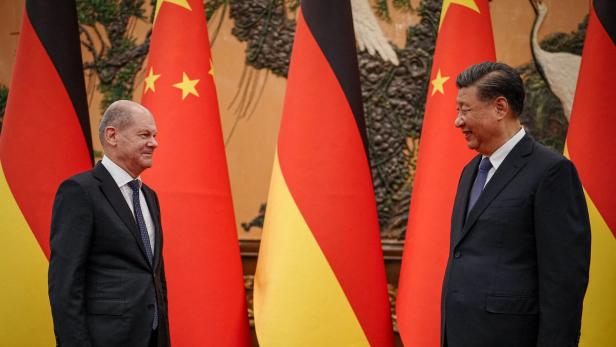



Kommentare