Wie Österreichs Energiebranche die Preise senken will

Bei Wasserkraft hat Österreich viel Expertise, die auch international gefragt ist.
Einmal im Jahr versammeln sich die Lenker heimischer Stromversorger, Netzbetreiber, Regulatoren und der Energiepolitik traditionellerweise bei einem großen Treffen, das abwechselnd vom Interessenverband Oesterreichs Energie und vom Verbund organisiert wird. 2025 ist es der Verbund Inspire Energy Summit, bei dem versucht wird, einen Blick von oben auf die heimische Energieversorgung zu werfen, den Status quo zu analysieren, vor allem aber einen gemeinsamen Weg in die Zukunft zu finden. Die schwierige Wirtschaftslage und globale Krisen gaben heuer genügend Anlass dazu, eine Art Masterplan zu skizzieren, durch den Energiepreise sinken und der Standort Österreich profitieren sollen.
Mehr Angebot senkt die Preise
Momentan hinke Österreich der sich langsam erholenden Wirtschaftsentwicklung in Europa eindeutig hinterher, erkennbar etwa an der hohen Inflation, meint Verbund-CEO Michael Strugl. „Bei der Frage, wer daran schuld ist, lautet die schnellste Antwort: Natürlich die hohen Energiepreise.“ Diese seien zwar nicht der einzige Faktor für die mangelhafte Wettbewerbsfähigkeit, sie seien im europäischen Vergleich auch nicht besonders hoch, aber sie sollten auf jeden Fall gesenkt werden.
Das beste Rezept dafür sei ein stärkerer Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Mehr Angebot senke die Preise. Wasser-, Wind- und Solarkraft seien die günstigsten Energieerzeugungsformen und Europa hätte dabei großes Potenzial – im Gegensatz zu fossilen Energien, deren Vorkommen am Kontinent vergleichsweise gering sind. Mit eigenständiger Energieversorgung verringere man Abhängigkeiten und erhöhe die Resilienz gegenüber geopolitischen Verwerfungen. Außerdem: „Die Erderwärmung schreitet immer schneller voran. Das kann uns nicht egal sein. Klimaschäden kosten viele Milliarden Euro, Anpassungen an den Klimawandel ebenso. Und wir haben eine Verantwortung für die nächsten Generationen“, so Strugl.
Man muss weniger Öl und Gas importieren
Im Inland herrscht dabei großer Aufholbedarf, sagt Gabriel Felbermayr, Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo). „Österreich ist von seinem Klimazielpfad bis 2040 aktuell um 25 Prozent entfernt.“ Für Importe fossiler Energien hat Österreich im Vorjahr 10 Milliarden Euro ausgegeben. 58 Prozent des Endenergiebedarfs werden durch Öl, Gas und Kohle aus dem Ausland gedeckt. Wenn man diese Importe ersetze, könne man Wertschöpfung im Land halten. „Der Ausbau der heimischen Erzeugung ist eine No-Regret-Maßnahme“, so Strugl. Man werde sie nicht bereuen.
Technologien im Bereich erneuerbare Energien seien zudem eine enorme Marktchance für heimische Unternehmen. Wasserkraft etwa „kann niemand so gut wie wir. Unsere Spezialisten sind weltweit gefragt“. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht den Ausbau der Erzeugung ebenfalls positiv. Er betont, wie wichtig der gleichzeitige Netzausbau ist, um die Versorgungssicherheit weiterhin auf dem bestehenden hohen Niveau zu halten. Dazu seien auch Maßnahmen wie ein Ausbau von Speichern und Steuermechanismen wie eine Spitzenkappung notwendig – womit vor allem die Windkraftbranche weniger einverstanden ist.
Geschickte Koordination kann Kosten massiv senken
Womit die Energiebranche generell wenig glücklich ist, ist die stärkere Beteiligung von Stromerzeugern an den Netzentgelten. Dies ist im kommenden Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) vorgesehen. Hattmannsdorfer steht dazu und begründet das mit den enormen Kosten des Netzausbaus, die nicht nur von Verbrauchern getragen werden sollen. Er will Erzeugern, die im europäischen Vergleich ohnehin schon hohe Netzentgelte zahlen, vor allem durch die Verkürzung von Genehmigungsverfahren entgegenkommen.
Ein weiterer starker Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung findet im besten Fall koordiniert statt und richtet sich nach dem Verbrauch. Die Koordination sei wichtig, um unnötige Kosten zu vermeiden. Ein geordneter Übergang sei immer besser als „Hauruck-Aktionen“, schildert Anton Burger vom Forschungsinstitut Compass Lexecon. In Österreich gebe es hier noch Verbesserungspotenzial. Im aktuellen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP) sei Photovoltaik überbetont, was Kosten erhöhe, wenn nicht gleichzeitig höhere Flexibilitäten im Netz (z.B. durch Speicher) geschaffen werden, sagt Strugl.
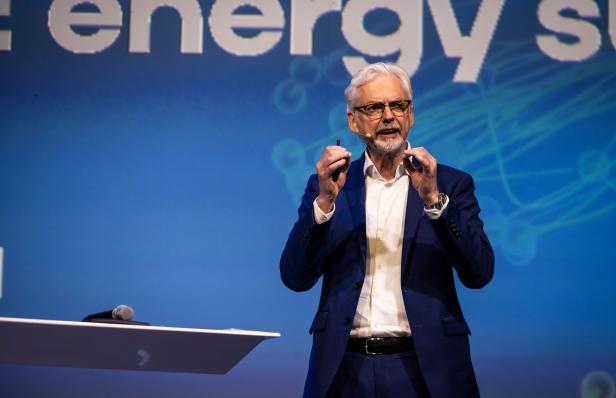
Verbund-CEO Michael Strugl: Erneuerbaren-Ausbau wird man nicht bereuen.
Elektrifizierung könnte schneller laufen
Beim Verbrauch sind wesentlich schnellere Fortschritte bei der Elektrifizierung verschiedener Gesellschaftsbereiche prognostiziert worden. Die Einführung von E-Autos oder der Austausch fossiler Heizsysteme schreite aber nicht so schnell voran wie gedacht. Dabei könnte man durch Veränderungen im Verbrauchsverhalten viel bewirken. „200.00 E-Autos bedeuten 110 Millionen Euro weniger fossile Importe“, sagt Felbermayr.
Bevölkerung muss mit an Bord sein
Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei für alle genannten Maßnahmen eine wichtige Grundvoraussetzung. Laut Umweltökonomin Sigrid Stagl von der WU Wien ist die allgemeine Akzeptanz von erneuerbaren Energien in Österreich bereits sehr hoch. Wenn es konkret wird, etwa um Projekte in der Nähe des eigenen Wohnortes, sieht es aber teilweise anders aus. „Junge Menschen und höher Gebildete zeigen tendenziell eine höhere Akzeptanz. Je mehr man ein Auto verwendet, desto geringer ist sie.“
Wie sich bei zahlreichen Projekten gezeigt habe, ist persönliche Kommunikation der Schlüssel, um größeres Verständnis zu erzeugen. Wichtig sei auch, die Vorteile aufzuzeigen, die die Transformation des Energiesystems für den Einzelnen bringt und sie an Projekten teilhaben zu lassen – etwa durch eine Einbindung in den Planungsprozess oder Bürgerbeteiligungsmodelle. „Wenn wir den Umbau bewältigen wollen, müssen wir die Leute mitnehmen“, sagt Strugl. „Da haben alle eine Aufgabe: Unternehmen, Behörden und Politik.“
Wichtig seien Ehrlichkeit und Transparenz. „Mit einem populistischen Ansatz wird es nicht gehen. Wenn man Leuten sagt, wir müssen nichts ändern, dann geht es euch wieder gut, wird das nicht funktionieren.“
Kommentare