Impfpflicht: Warum Omikron rechtlich Probleme macht
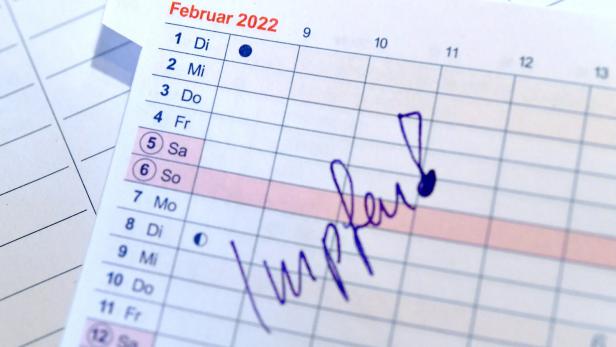
Es war der letzte Punkt, auf den sie sich in der Nacht davor geeinigt hatten: Als die Konferenz der Landeshauptleute am 19. November in Pertisau am Achensee mit der Bundesregierung eine Vereinbarung unterschrieb, da fand sich unter Punkt 8 eine bahnbrechende Verpflichtung: Man wolle ein "Gesetzgebungsverfahren" starten, das ein Ziel hat: eine "allgemeine Impfpflicht", die "spätestens am 1. Februar in Kraft tritt".
Exakt drei Monate später ist die allgemeine Impfpflicht formal zwar in Kraft. Ob all ihre Stufen (punktuelle Kontrolle und Strafen ab Mitte März, Abgleich von Melde- und Impfregister ab April) aktiviert werden, ist in diesen Tagen aber umstritten, mehr noch: In der Regierung mehren sich die Zweifel, ob die Impfpflicht verfassungsrechtlich weiterhin hält. Und das liegt – auch – daran, dass man sie mitten in einer Infektionswelle einführte, in der sich noch dazu eine gänzlich neue Virusvariante durchsetzt.
Ein Blick zurück:
Am 11. November 2021 prophezeit Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der Winter und die Weihnachtsfeiertage würden für Ungeimpfte ausnehmend "ungemütlich". Von einer Impfpflicht für alle ist noch keine Rede, Schallenberg will nur über eine "Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen" diskutieren. Der Diskussionsprozess ist ein kurzer. Tags darauf, am 12. November, vermeldet Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, er werde die Impfpflicht verordnen – vorerst nur für Gesundheitsberufe. Corona-Leugner und die FPÖ sehen die Regierung "von allen guten Geistern verlassen", die Ärztekammer begrüßt den Schritt – und schlägt eine Ausweitung auf Pädagogen, Nachmittagsbetreuer und Polizisten vor.
Am 18. November fordert der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer eine bundesweite Impfpflicht, tags darauf wird sie am Achensee paktiert – und am 20. Jänner vom Nationalrat verabschiedet.
Schon zu diesem Zeitpunkt wird deutlich, dass die medizinisch unumstrittene Maßnahme rechtlich zu einer Herausforderung wird.
Denn im Unterschied zu anderen EU-Staaten wie Belgien oder Italien, die die Impfpflicht längst umgesetzt haben, will Österreich diese nicht auf bestimmte Berufs- und Altersgruppen beschränken, sondern für alle in Kraft setzen. Eine derart umfassende Verpflichtung muss noch schärfer und besser argumentiert werden als die Impfpflicht für vulnerable Gruppen und deren Kontakte. Und genau hier kommt die neue Omikron-Variante ins Spiel, die – rein grundrechtlich – zum Problem wird.
Warum? Vereinfacht gesagt gibt es nur einen Grund, der es der Politik erlaubt, Menschen zur Impfung zu zwingen: Das Gesamtgefüge der Gesellschaft ist in Gefahr.
Das war angesichts der Delta-Variante gegeben, die Intensivstationen gerieten an die Leistungsgrenze.
Doch schon am 5. Februar, als die erste Stufe der Impfpflicht gilt, ist absehbar: Omikron bringt das Gesundheitssystem nicht so in die Bredouille wie die Vorgänger. Dazu nur eine Zahl: Obwohl sich ab 21. Jänner durchgehend täglich mehr als 25.000 Menschen infizieren, sind 14 Tage später nicht einmal 200 Intensivbetten belegt.
Was folgt, ist eine Gegenbewegung: Am 10. Februar sagt Peter Kampits, stellvertretender Chef der Bioethik-Kommission, die Impfpflicht sei ethisch "nicht verantwortbar". Und Bundeskanzler Karl Nehammer begräbt am 13. Februar nicht nur die Impflotterie, sondern räumt zudem ein, die Impfpflicht könne ausgesetzt werden.
Es ist gut möglich, dass es genau so kommt, sprich: Der Gesundheitsminister aktiviert die weiteren Stufen der Impfpflicht vorerst nicht.
"Will man den Weg der allgemeinen Impfpflicht weitergehen, so muss man argumentieren können, welches große Bedrohungsszenario man damit verhindert", sagt Verfassungsrechtler Christoph Bezemek, Dekan an der Universität Graz. Was Omikron angeht, fällt die Überlastung der Intensivstationen als Argument zunehmend weg.
Und ob die Impfpflicht-Kommission ein anderes rechtliches Argument findet, zeigt sich spätestens am 8. März. Dann nämlich muss ihr erster Bericht vorliegen.
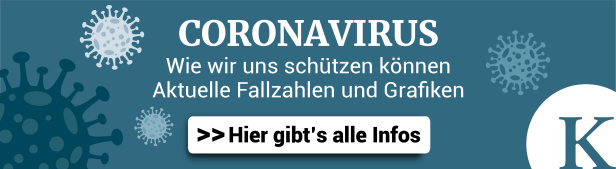



Kommentare