Wie das Heizen die Gemüter erhitzt – in Deutschland, der Schweiz, bei uns

Obschon alle Staaten seit Jahren bis Jahrzehnten über Klimaneutralität reden – wenn es um konkrete Maßnahmen und in die "heiße" Phase geht, geht der Streit erst los. So gesehen in Österreich, wo das Erneuerbare-Wärme-Gesetz im Parlament immer noch in den Seilen hängt.
Oder in Deutschland, wo ein radikaler Heizungstausch samt Wärmepumpen-Ersatz die Grundsatzunterschiede der Koalitionspartner offenbarte und beinahe zu einer veritablen Regierungskrise führte.
In der Schweiz mit ihrer direkten Demokratie, in der alles ein bisschen länger dauert, einigte sich die Bevölkerung erst am Sonntag per Referendum mit rund 59 Prozent Zustimmung auf ein Ja zur Wärmewende. Das Referendum war von der Rechtspartei SVP, der stimmenstärksten im Land, erzwungen worden; sie mobilisierte mit Angstszenarien wie der Zerstörung der Landschaft durch Windräder und Solarpaneele – und kalten Duschen. Die Mehrheit der Bevölkerung scheint sich davor aber weniger zu fürchten als vor den Auswirkungen aufs Klima, die der weitere Ausstoß fossiler Energien hat. In den letzten 150 Jahren ist die Durchschnittstemperatur in der Schweiz um fast zwei Grad Celsius gestiegen – doppelt so viel wie im globalen Schnitt.
-
Österreich: Neuer Anlauf für ein Aus für Öl und Gas
Wer in Österreich ein neues Wohnhaus baut, darf keine Ölheizung einbauen. Das ist bisher die einzig gültige Regelung. Eigentlich war geplant, dass ab dem 1. Jänner 2023 auch keine Gasheizungen mehr im Neubau installiert werden dürfen.
➤ Mehr lesen: SPÖ beendet Blockade im Parlament: Was jetzt kommt
Doch weil das Gesetz, das dies regeln sollte, konkret das "Erneuerbare-Wärme-Gesetz", noch immer nicht vom Nationalrat beschlossen ist, mag es zwar nicht klug sein, jetzt eine Gasheizung einzubauen – verboten ist es aber nicht.
Dabei ist schon lange klar, dass das früher oder später passieren wird. Derzeit sind in Österreich rund 530.000 Ölheizungen in Wohngebäuden in Betrieb, weiters befinden sich rund 100.000 Ölheizungen in Dienstleistungsgebäuden. Der Bestand an Kohleheizungen ist mit circa 11.000 Anlagen gering. Dagegen ist der Bestand fossiler Gasheizsysteme mit 1,25 Millionen Anlagen vergleichsweise hoch, wovon sich über eine Million in Wohngebäuden und der Rest in Dienstleistungsgebäuden befinden. Den größten Anteil der fossilen Gasheizungen machen mit rund 650.000 Anlagen Gasetagenheizungen aus (Thermen in einzelnen Wohnungen).
Macht in Summe 1,9 Millionen fossile Heizungssysteme, die gegen Wärmepumpen oder andere nachhaltige Heizungssysteme getauscht werden müssen, damit Österreich bis 2040 klimaneutral werden kann.
Das Gesetz sieht vor, dass schrittweise, beginnend mit den ältesten Modellen, ein Tausch notwendig werden wird, weil der Betrieb verboten wird.

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), im Hintergrund Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).
Ab 2025 (so der ursprüngliche Plan) gäbe es ein Tauschgebot für die ältesten Öl- und Gasheizungen. Bis 2035 sollen dann alle Ölheizungen verschwunden sein, bis 2040 auch alle Gasheizungen.
Gefördert wird der Tausch vom Bund (es gibt noch neun unterschiedliche Landesförderungen) mit bis zu 7.500 Euro, zudem gibt es einen "Raus aus Gas"-Bonus in der Höhe von 2.000 Euro. Neue thermische Solaranlagen werden außerdem mit einem 1.500-Euro-"Solarbonus" bezuschusst.
-
Deutschlands verzögerte "Zeitenwende": Gasheizung darf bleiben
In Deutschland hätte die Wärmepumpe beinahe eine Regierungskrise ausgelöst: Monatelang stritten SPD, Grüne und FDP um das Heizungsgesetz, das im radikalen ersten Entwurf vorsah, dass jede neu eingebaute Heizung ab 2024 mit mindestens 65 Prozent Erneuerbarer Energie betrieben werden muss – ein De-facto-Verbot für neue Öl- und Gasheizungen. Das Ziel: klimaneutral bis 2045.

Kanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), im Hintergrund Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).
Groß war die Aufregung: Anbieter warnten vor einem Sturm auf Gasheizungen vor Jahresende und einer unbewältigbaren Menge an einzubauenden Wärmepumpen (pro Jahr mindestens 500.000 neue Wärmepumpen wären für Erreichen des Zieles nötig); der Koalitionspartner FDP fürchtete die Finanzierung der staatlichen Förderung. Derzeit sind erst drei Prozent aller Wohngebäude mit Wärmepumpen ausgestattet, die im Schnitt 31.000 Euro kosten – dreimal so viel wie eine Gasheizung. 40 Prozent der Kosten übernimmt der Staat.
➤ Mehr lesen: Warum die Ampel am Umfragehoch der AfD mitschuld ist
Vergangene Woche die Einigung: Die neue Vorgabe soll nur für Neubauten gelten. Dort sollen Gasheizungen nur dann weiterhin erlaubt sein, sofern sie auf Wasserstoff oder Biogas umgerüstet werden können. Bestehende Heizungen dürfen repariert werden.
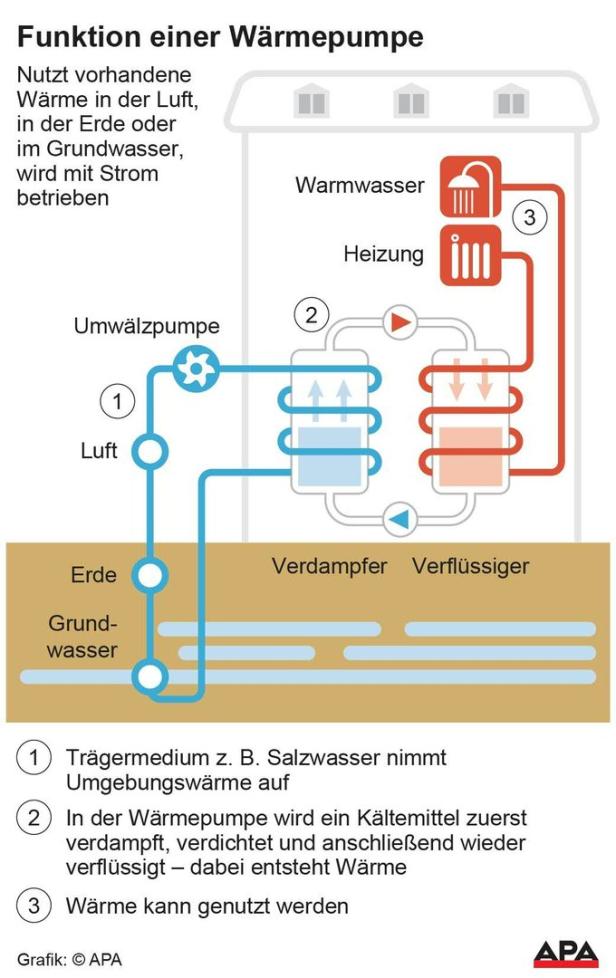
Weiters soll die Hauptverantwortung für die Energiewende an die Städte und Gemeinden übergehen: Die müssen bis 2026 (kleinere Kommunen bis 2028) einen Plan erarbeiten, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen, etwa durch Fernwärme oder Wasserstoffanbindung. Erst dann sollen alte Heizungen innerhalb von drei Jahren getauscht werden. Damit verschiebt sich der Umstieg für über eine halbe Million Haushalte um zwei bis vier Jahre.
Das Gesetz soll vor 7. Juli im Bundestag beschlossen werden. Vieles, wie die finanzielle Unterstützung, ist noch unklar. Kritik gibt es von Umweltverbänden. Im Europavergleich liegt Deutschland bei der Energiewende nur im Mittelfeld: Über 60 Prozent aller Neubauten werden mit Erneuerbaren Energien beheizt. Im Vorjahr wurden 600.000 Gasthermen neu eingebaut – trotz Energiekrise.
-
Schweiz: Wärmewende mit fast keinen Verboten
In der Eidgenossenschaft hat stets die Bevölkerung das letzte Wort. Die entschied am Sonntag per Referendum, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral werden muss.
Das Klima- und Innovationsgesetz, wie es korrekt heißt, sieht den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energieträgern vor – mit Förderanreizen, ohne Verbote und neue Abgaben. Dafür wird die Schweiz nun, zusätzlich zu bestehenden Förderprogrammen, den privaten Umstieg von einer Öl-, Gas- oder Elektroheizung auf eine Wärmepumpenanlage oder eine Holzheizung in den kommenden zehn Jahren mit zwei Milliarden Franken (knapp zwei Milliarden Euro) fördern.
Das Gesetz war von Parlament und Bundestag ausgearbeitet und von allen großen Parteien, den Tourismus-, Wirtschafts- und Bauernverbänden unterstützt worden. Nur die rechtsnationalistische Schweizer Volkspartei (SVP), die größte Partei, hatte zur Verhinderung des Gesetzes ein Referendum initiiert. Sie sprach von einem "Stromfressergesetz", das den Stromverbrauch fördern und die Energiekosten erhöhen würde. Die Mehrheit der Bevölkerung schien das aber anders zu sehen.

Befürworter des Klima-Gesetzes in der Schweiz feiern das Ergebnis der Abstimmung: 59 Prozent votierten dafür.
Der Ausstieg aus fossiler Energie schreitet seit Jahren voran. 2008 wurde eine CO2-Bepreisung eingeführt – auch mit dem Ziel, die Abhängigkeit aus dem Ausland zu reduzieren. Aktuell werden drei Viertel der Energie, vor allem Öl und Gas, importiert; Strom wird zu 60 Prozent selbst produziert, vorwiegend aus Wasserkraft, und ist sogar etwas günstiger als im Europavergleich.
Der Einsatz von Wärmepumpen ist weiter verbreitet als in Österreich oder Deutschland: Ende 2021 waren 17 Prozent der Wohngebäude mit Wärmepumpen ausgestattet. Gelungen ist das, weil sich die Schweiz auf ein bestimmtes Anlagenschema geeinigt hat. Seit 2019 sind Wärmepumpen sogar bei Ikea erhältlich. In einzelnen Kantonen gibt es bereits ein Verbot zum Neueinbau von Öl- und Gasheizungen: Zürich hat dieses 2021 mit einer Zustimmung von 62,2 Prozent der Bevölkerung angenommen.
➤ Mehr lesen: Der Schweizer Sonderweg: Warum die Inflation 2022 nur 2,8 % betrug
Kommentare