"Wir werden nie günstiger sein": Europas Autoexperten über den Weg nach vorn

Zusammenfassung
Die europäische Autoindustrie steht vor massiven Herausforderungen durch Transformation, Nachfragerückgang, neue Wettbewerber und regulatorische Unsicherheiten. Politik, Unternehmen und Gesellschaft müssen gemeinsam handeln, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und den Wandel aktiv zu gestalten.
Die europäische Autoindustrie befindet sich in Transformation: Nie zuvor in ihrer Geschichte musste sie derart viele Veränderungen gleichzeitig wegstecken, wie aktuell. Das führt zu groben Verwerfungen – neue Konkurrenz, neue Technologien, neue Marktbedingungen – und kostet Jobs. Wie sieht die Zukunft aus? Die Branchenkenner Roland Prettner (Magna), Stefan Fink (FH Steyr und KPMG) und Stefan Bratzel (Center of Automotive Management) haben fundierte Antworten.

Stefan Fink, FH Steyr und Chefökonom KPMG Austria.
KURIER: Der Industriestandort Europa ist unter Druck, die Autoindustrie trifft es besonders. Wie ist Ihre Einschätzung?
Stefan Bratzel: Wir haben die kritischste Situation in der deutschen bzw. europäischen Autoindustrie insgesamt. Wir haben längerfristige Nachfragerückgänge, seit 2019 einen um 18 Prozent geringeren Neuwagenabsatz in Europa. Das sind 2,5 bis 3 Millionen Fahrzeuge weniger. Wir haben die Transformation der Branche in Richtung Elektromobilität, Richtung softwaredefiniertes Auto und längerfristig auch autonomes Fahren. Das sind Riesenumorientierungen, die viel Geld kosten und auch die Wertschöpfung neu verteilen. Zudem haben wir neue Wettbewerber aus China, die immer stärker werden und innovationsstärker geworden sind. Und das letzte Thema: Die Zollkapriolen kommen quasi noch mal on top. Die sind gerade für Deutschland als exportorientiertes Land eine Riesenproblematik. Und das alles in einer Zeit hoher Volatilität, hoher Turbulenz. Das ist für eine anlagenorientierte Branche eine Riesenherausforderung.
Roland Prettner: Weltweit ist die Autobranche ein leicht wachsender Markt. Wenn Sie sich aber anschauen, woher das kleine Wachstum kommt, das es noch gibt, dann ist das Asien. Nordamerika und Europa bleiben flach, und das für die nächsten zehn Jahre. Wir befinden uns in der größten Transformation der Automobilgeschichte. Aber die Technologie ist noch immer am Reifen. Das verursacht, dass sich Käufer überlegen: Was kaufe ich mir jetzt noch? Da ist viel Abwarten. Aber man muss schon auch sagen: Es ist ein Markt mit rund 15 Millionen Fahrzeugen in Europa, das ist schon etwas, mit dem man arbeiten kann. Wir sehen zwar kein Wachstum, aber auch nicht den totalen Einbruch. Ein Punkt ist auch noch, dass die chinesischen Automarken in Europa wachsen werden. Wie viel, wird man sehen. Ich vermute, sie werden zehn bis 15 Prozent vom Markt gewinnen können. Es wird also Spieler geben, die Anteile verlieren.
Stefan Fink: Es ist ein mehrfacher Schock von der Angebotsseite. Das hat mit den Lieferketten begonnen, den hohen Energiepreisen, der Teuerung, den Lohnkosten, das alles parallel mit regulatorischen Herausforderungen. Und da habe ich die Nachfragekomponente noch gar nicht erwähnt – das alles gilt es zu bewältigen. Diese Herausforderung sind gepaart mit Unsicherheit, die auf einem historischen Höchststand ist.
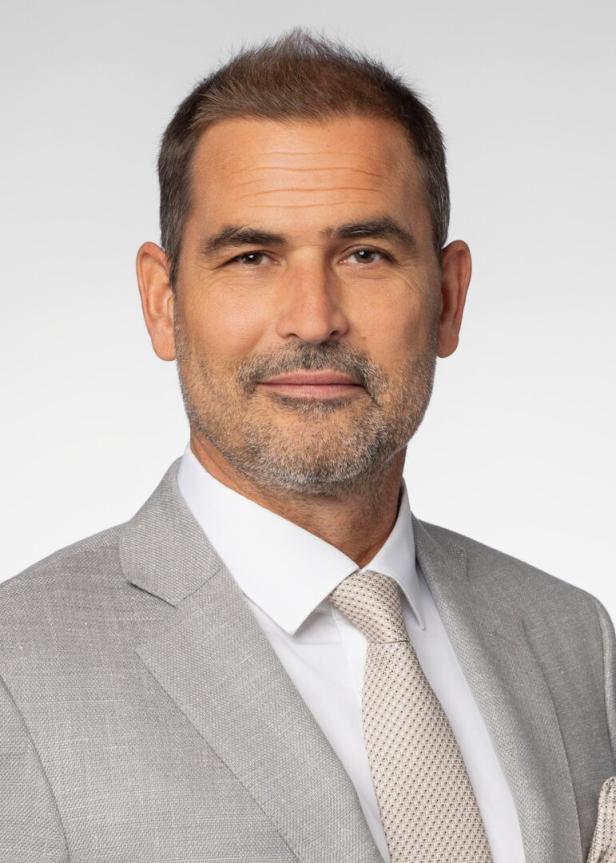
Roland Prettner, Präsident Magna Steyr.
Wie gefährdend ist das alles im Moment. VW-Boss Blume spricht vom "perfekten Sturm". Wie sehr ist denn das auch hausgemacht?
Bratzel: Es ist schon fünfzig fünfzig. Autohersteller wie Volkswagen oder Mercedes müssen mindestens so viel besser und innovativer sein, wie sie teurer sind. Und das waren sie auch lange Zeit. Es hat sich aber geändert, weil es eben Wettbewerber gibt, die ähnlich innovativ sind oder sogar in dieser Transformation noch innovativer sind, etwa im Bereich Elektromobilität. Und das verändert plötzlich dieses Spiel. Wenn man nicht mehr besser und innovativer ist, kann man auf Dauer auch nicht mehr teurer sein. Und das trifft im Moment in Deutschland besonders die Autoindustrie. Die Rechnung stimmt nicht mehr. Fakt ist: Wir werden nie günstiger sein, wir müssen aber wieder die Besten sein. Wir müssen vor die technologische Welle kommen.
Fink: Auf der Makroebene ist das ein ähnliches Thema. Man hat lange versucht, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen so zu setzen, dass man von der Wirtschaftskrise möglichst wenig merkt. Seit 2022 geht es aber massiv auseinander: was wir tatsächlich verdienen und was wir in Löhnen zahlen. Die Produktivität ist rückläufig, wir werden aber teurer. Das bedeutet, wir verlieren im Wettbewerb. Die gute Nachricht ist, dass die Wirtschaft sehr resilient ist. Aber wir müssen erkennen, dass wir eine Fitnesskur brauchen. Strukturreformen sind nichts toxisches, sondern notwendig.
Prettner: Für Erfolg braucht es Technologie und Kultur. Europa war bekannt dafür, bis in die Zweitausenderjahre, da ist praktisch jede Technologie aus Europa gekommen. Was kommt heute noch? Gar nichts mehr. Wir haben die großen Wetten nicht abgeschlossen. Im Auto haben wir die tollsten Materialien, die besten Spaltmaße, die schönste Außenhaut, den besten Lack. Aber es ist nicht unbedingt das, was der Kunde jetzt sexy findet. Die deutschen Hersteller waren im Motorenbau weit vorne – das konnte niemand einholen. Das ist aber nicht mehr so wichtig, weil die Fahrzeuge jetzt Elektromotoren haben und Connectivity entscheidend ist. Da sind andere Länder und Marken voraus. Wir müssen bei den richtigen Technologien wieder ganz vorne sein und entsprechend investieren. Nur haben wir in unserem Tiefschlaf seit der Corona-Zeit, wo wir uns von zu Hause die Welt angeschaut haben, übersehen, dass andere richtig losgelegt haben. Und dann ist da noch das Kulturthema. Es braucht 450 Millionen Europäer, die richtig Gas geben. Es liegt an uns als Führungspersönlichkeiten, dieses Momentum zu erzeugen. Es braucht eine positive Einstellung zu Arbeit und Unternehmertum. Wir sind nervös machend entspannt geworden. Aber: Es beginnt sich zu drehen, das sieht man an den letzten KV-Verhandlungen. Es geht auch nicht darum, was jedem zusteht – es geht darum: was können wir uns noch leisten, wenn wir Produkte erzeugen, die Preise haben, die keiner kauft.

Stefan Bratzel, Direktor Center of Automotive Management.
Wir stehen vor massiven Transformationsaktivitäten, verlieren Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, haben eine Nachfragekrise, ein Vertrauensthema in Technologien, ein Problem mit Regulatorien. Wie kommen wir da raus? Was ist Ihre Vorhersage für die nächsten zwei Jahre?
Prettner: Man kann mit hoch ausgebildeten und top motivierten Mitarbeitern viel erreichen. Und es gibt eine gewisse Umkehr. Die Zeiten, wo alle eifrig nachgedacht haben, wie viel Home-Office kann man machen und mit wie wenig könnte man die Stunden runterbringen, das ist vorbei. Aber ich will gar nicht alles so schlecht reden: Wir sind in einem flachen Markt. Das ist ein bisschen anstrengend, aber es ist managebar. Wir brauchen Top-Technologien in Top-Unternehmen. Top-Flagship-Companies, die uns vorwärts bringen. Das müssen wir jetzt drehen. Ich sehe da viel Verständnis bei der Bevölkerung und in der Politik.
Bratzel: Ich hatte in der Vergangenheit das Gefühl, dass wir eine gewisse Sattheit haben. Wir müssen von dieser Dekadenz wegkommen, das ist ein kulturelles Thema. Raus aus der Komfortzone. Ich habe vor zwei Jahren beim Autogipfel in Deutschland das gleiche gesagt, was ich heute auch sage: Technologisch müssen wir in die Gänge kommen, das ist keine kurzfristige Sache. Wir brauchen eine Art europäischen Pakt zwischen Politik, Automobilindustrie und Gewerkschaften.
Fink: Es ist eine Frage des Leidensdrucks. Tut es schon weh genug? Exogene Schocks können wir nicht steuern, aber was wir selber gestalten können, das sollten wir in die Hand nehmen. Investitionen und das Verhalten der Konsumenten ist sehr stark von Erwartungen abhängig. Wir brauchen einen Businessplan, der kann Erwartungen bilden und daraus kommt ein positives Feedback. Das erhoffe ich mir. Das ist nicht volkswirtschaftliches Wunschdenken, sondern eine Storyline, die die Menschen mitnimmt. Das schafft Perspektive.
Das ist ja dann etwas, das die Unternehmenslenker machen müssen. Die großen Bosse bei VW, Mercedes, BMW, können die das?
Prettner: Die Zeiten der großen Planung sind vorbei. Das kommt auch nie mehr. In sechs Monaten werden uns Themen beschäftigen, die wir heute noch gar nicht kennen. Schon Goethe hat vor 200 Jahren erkannt, dass sich die Erde noch nie so schnell gedreht hat. Damit muss man umgehen können. Man kann mitgestalten und man kann seine Unternehmer so aufstellen, dass man extrem schnell und flexibel mit Situationen umgehen kann. Und damit die Zukunft gestalten. Da gehen ich davon aus, dass jedes Unternehmen die besten Leute ganz oben hinsetzt. Es ist immer das gleiche mit dem Wohlstand: man arbeitet sich hoch, ist fleißig, freut sich, macht es sich bequem und kommt drauf, dass man so den Anschluss verliert. Es ist ein natürlicher Zyklus und es ist gut, dass wir das jetzt erkennen.
Ist die Politik am Zug, die Rahmenbedingungen zu verändern?
Bratzel: Ja auch, aber nicht alleine. Alle müssen ran, die Politik, die Unternehmenslenker, die Mitarbeiter, die Konsumenten, die Gewerkschaften, um die richtigen Weichen zu stellen.
Prettner: Die strikte Vorschreibung des Verbrennerverbots 2035 war damals vielleicht sogar richtig. Weil es ein großes Momentum erzeugt hat, Richtung Investitionen und Elektromobilität. Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem die Elektromobilität niemand mehr aufhalten wird. Das passiert. Es ist einfach die bessere Technologie, noch nicht ganz ausgereift aber auf gutem Niveau. Da braucht es nicht mehr unbedingt eine Vorschrift, das wird der Markt jetzt selbst lösen. Die Entscheidung ist gefallen, das liegt hinter uns, erledigt.
Bratzel: Ich war nie der Freund des strikten Verbrennerverbots. Weil es zu ideologischen Grabenkämpfen geführt hat. Das hätte man viel eleganter lösen können, weil es ist völlig egal, ob da 2035 noch ein paar Prozent Verbrenner dabei sein. Aber wenn man das jetzt aufweicht, schafft man noch mehr Verunsicherung. Gerade bei den Leuten, die bis jetzt resistent waren.
Fink: Eine regulatorische Unsicherheit ist immer schlecht. Da sollte man auch keine neuen Erwartungen in Aussicht stellen. 'Vielleicht dann doch' ist eine schlimme Ansage für die Wirtschaft. Es kann nur ein Gleichschritt sein zwischen Unternehmen und der Politik.
Steht sich Europa wirtschaftlich selbst im Weg?
Prettner: Europa nimmt sich auch immer viel mehr vor, als nur wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das halte ich auch für durchaus richtig. Wichtig ist, dass wir den Mut bekommen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nicht jene, die besonders populär sind oder besonders bequem.
Kommentare