Gendern: Wieso geschlechterneutrale Sprache die Gesellschaft spaltet

Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter so sehr wie die Gendersprache. Eigentlich soll sie dazu dienen, alle Geschlechter sichtbar zu machen und damit ein Gefühl von Gerechtigkeit und Akzeptanz vermitteln. In der Realität führt sie aber meist zu emotionalen Debatten und Verdruss.
Wie sehr man sich hierzulande immer noch an einer geschlechtergerechten Sprache stört, zeigt der Start des aktuellen "anti-gendern-Volksbegehrens".
Initiator des Begehrens, Stefan Grünberger, fordert darin die Aufhebung des Gendersterns und des Binnen-I: "Nicht zu gendern muss in unterschiedlichsten Bereichen, Hochschulen, Ämtern, Firmen frei von Zwang sein und darf nicht verpflichtend vorgeschrieben werden", so die Forderung.
Aber woher kommt dieser Hass in der Gesellschaft - und stört geschlechterneutrale Sprache im Alltag tatsächlich?
➤ Mehr dazu: Männer mitgemeint
Sabine Grenz ist Professorin für Gender Studies an der Universität Wien. Sie stellt klar: "Gegendert wird immer, wenn man spricht. Auch wenn man das generische Maskulinum benutzt, wird gegendert. Nur eben männlich." Jedoch spreche man dabei nicht geschlechterinklusiv, so der Einwand der Professorin.
Geschlechtergerechtes Schreiben ist eine Minderheit
Im Gegenteil, "die meisten Texte, die wir lesen, sind immer noch im generischen Maskulinum geschrieben. Das geschlechtergerechte Schreiben ist eine Minderheit." Einen Grund dafür sieht Grenz in der "grammatikalischen Holprigkeit". „Geschlechtergerechte Sprache klingt abgehakt und umständlicher."
Der Weisheit letzter Schluss sei mit den derzeitigen Regeln jedenfalls noch nicht gefunden, meint Grenz. Das bestätigen auch die Ergebnisse einer Umfrage zum Gendern in Österreich aus dem Februar dieses Jahres. Demnach sind 58 Prozent der Meinung, dass geschlechtergerechte Sprache schwer zu verstehen sei.
Das generische Maskulinum bezeichnet den Gebrauch der männlichen Form für eine Allgemeinheit („jeder Arzt“ für alle Ärzte und Ärztinnen) oder gemischtgeschlechtliche Gruppen („die Ärzte“ für eine Gruppe Ärzte und Ärztinnen). Kritisiert wird daran, dass durch das generische Maskulinum Frauen sprachlich unsichtbar gemacht werden.
Dabei gehe es aber vor allem auch um Gewöhnung, meint die Professorin für Gender Studies: "Die gendergerechte Sprache regt auf, weil sie ungewohnt ist." Sie schaffe ein Schriftbild ab, mit dem sich die Menschen bereits arrangiert hätten. "Am Anfang fällt es einem vielleicht noch schwer, aber man gewöhnt sich daran", ist Grenz überzeugt.
Frauen sind ohnehin mit gemeint?
Viele Menschen empfinden die Debatte aber auch als überflüssig, weil sie davon ausgehen, dass Frauen ohnehin immer mit gemeint sind. Zahlreiche Studien zeigen allerdings, dass diese Behauptungen ins Leere laufen.
Die deutsche Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch gilt zusammen mit Senta Trömel-Plötz und Marlis Hellinger als Begründerin der feministischen Linguistik in Deutschland. Pusch erkannte bereits vor dreißig Jahren das Problem der exklusiven Sprache. Sie meinte damals: "99 Sängerinnen und 1 Sänger sind zusammen 100 Sänger. Futsch sind die 99 Frauen, nicht mehr auffindbar, verschwunden in der Männerschublade."
Ein Problem mit der Gleichberechtigung
Grenz meint, dass jene Menschen, die sich von gendergerechter Sprache angegriffen fühlen, generell ein Problem mit der Forderung nach Gleichberechtigung haben. „Sie fürchten, dass ihnen mit der zusätzlichen Erwähnung anderer Geschlechter im übertragenen Sinne selbst weniger Raum gegeben wird.“
Erst wenn man aber gendergerecht spricht, so die Professorin, mache man tatsächlich alle Menschen sichtbar: "Ich führe eine sprachliche Gleichberechtigung ein."
Auch wenn es - so die Expertin - vermutlich noch eine Weile dauern wird, bis man die "perfekten" Regeln für eine geschlechterneutrale Sprache finden wird: " Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft, da gehört es dazu, dass alle mit einbezogen werden."
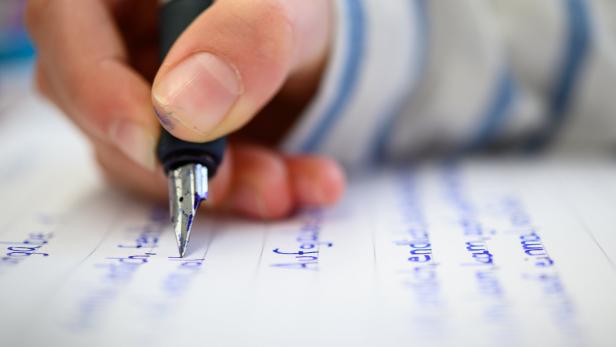

Kommentare