#MeToo in der österreichischen Filmbranche: "Wir kennen die Namen"
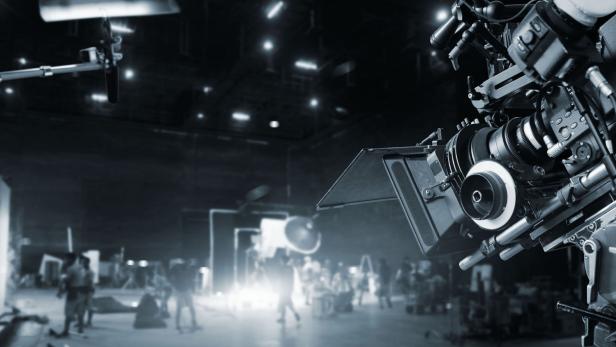
Wenn Donnerstagabend der Österreichische Filmpreis verliehen wird, mischen sich Misstöne in die Festlichkeit. Denn die heimische Filmbranche wird seit vergangener Woche von einer Welle an #MeToo-Vorwürfen gebeutelt: Zahlreiche Frauen schilderten anonym, wie sie Opfer von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen wurden.
Zuerst berichtete Regisseurin Katharina Mückstein auf Instagram von ihren niederschmetternden Erfahrungen – und rief Betroffene dazu auf, sich ebenfalls zu melden. Daraufhin gingen unzählige Nachrichten ein, die Mückstein anonymisiert teilte und die ein verstörendes Licht auf die Branche werfen: Frauen beschreiben darin entwürdigende Casting-Situationen, Beleidigungen, Belästigungen und Stalking bis hin zu (versuchten) Vergewaltigungen.
Auch sehr viele junge Frauen meldeten sich mit ihren bitteren Erfahrungen zu Wort und machten damit die Hoffnung, viele der Missstände lägen in der Vergangenheit, zunichte. Seit im Jahr 2017 amerikanische Schauspielerinnen konkrete Vorwürfe gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein erhoben, die letztlich zu dessen Verurteilung führten, hat sich offensichtlich in Österreich nicht viel geändert.
Erschüttert
Auf politischer Ebene zeigt man sich über das hier öffentlich gemachte Bild der Filmbranche schockiert: Staatssekretärin Andrea Mayer sei „erschüttert von den aktuellen Berichten aus der Film- und Theaterszene, die leider immer noch ein trauriges Bild von Machtmissbrauch und sexueller Gewalt zeigen. Klar ist: So etwas hat im Kulturbereich nichts verloren“, ließ ein Sprecher auf KURIER-Anfrage verlauten.
Der Kulturbereich ist jedoch sogar besonders anfällig für Übergriffe und Machtmissbrauch. Konkrete Maßnahmen jedoch lassen auf sich warten – oder sind langfristig angelegt, ohne akut zu helfen. So soll „noch heuer“ eine Vertrauensstelle für Kunst, Kultur und Sport ihre Arbeit aufnehmen. Sie wird Beratungen bieten und mit Workshops und Bewusstseinsbildung für Prävention sorgen. Zudem wurde ein „Fairness Codex“ entwickelt, der die Leitlinien für ein faires Miteinander für alle im Kulturbereich Tätigen definiert.
Das Österreichische Filminstitut (ÖFI), der größte heimische Fördergeber der Branche, hat darüber hinaus Verhaltensregeln entwickelt. Sie gelten als Leitbild für alle vom ÖFI geförderten Produktionen. Darin findet sich folgender Eintrag: „Wenn Sie Belästigung, respektloses oder schikanöses Verhalten gegenüber einer anderen Person beobachten, haben Sie die Pflicht, zu handeln. Ignorieren Sie es nicht. Zeigen Sie, dass Sie es nicht dulden. Seien Sie proaktiv, sprechen Sie es sofort an oder versuchen Sie, angemessen einzugreifen.“
"Das hätte die Produktion aufgehalten"
Dass diese Verhaltensvorgaben in vielen Produktionssituationen offenbar reines Wunschdenken bleiben, zeigen nicht zuletzt die Postings Betroffener. Seit dem Hochkochen der Debatte vermeldet die Anlauf- und Beratungsstelle für Filmschaffende #we_do „deutlich mehr Betroffenenanfragen“, wie Gesundheitspsychologe Daniel Sanin dem KURIER schildert.
Ein Fall hat sich ihm besonders eingeprägt: „Es gab ein Beispiel von einem massivem Gewaltübergriff mit vielen Zeuginnen und Zeugen. Als wir gefragt haben, warum niemand die Polizei gerufen hat, hieß es: Das hätte die Produktion aufgehalten. Hier werden gemeinsam Mechanismen mitgetragen, die außerhalb rechtlicher Regelungen gesehen werden – was dazu führen kann, dass auf zwischenmenschliche Mindeststandards gepfiffen wird.“
Immer noch gebe es das Bild von "Kunstproduktion als Ausnahmezustand", "wo man sowieso über Grenzen geht". Durch die engen Strukturen komme man zudem schnell in eine Abhängigkeit "und will es sich deshalb mit niemandem ,verspielen‘". "Und es spitzen sich hier allgemeine Tendenzen zu, wie das Ich-AG-Dasein. Man muss sich um sich selbst kümmern, alle anderen sind potenzielle Konkurrenz. In Ausnahmesituationen, etwa wenn das Budget knapp bemessen ist, kommt es dadurch leichter zu einer Entsolidarisierung und Machtmissbrauch.“ Besonders sei auch, dass die Filmarbeit körperbezogen ist, "das bietet mehr Einfallstore für Grenzüberschreitungen".
Je tiefer man im Ranking angesiedelt ist, desto eher ist man Übergriffen ausgesetzt: „Eine Maskenbildnerin muss eher fürchten, dass sie rausfliegt und eine andere Person ihren Job bekommt. Die Leute beißen durch bis zur Selbstschädigung, um ja nicht auf der ‚schwarzen Liste‘ zu landen, mit der auch gedroht wird.“ Aber nicht nur Frauen, auch Männer seien betroffen, "durch Homophobie oder weil sie bestimmten Klischees nicht entsprechen“.
Druck von oben
Im Zuge der Debatte wurde der Ruf nach „Druck von oben“ laut: Inwiefern wäre es sinnvoll, an die Vergabe von Filmgeldern verpflichtende Regelungen zu knüpfen, die ein sicheres Arbeitsklima begünstigen? Zeitnah wird auch das jedenfalls nicht umgesetzt. Ob und welche Maßnahmen in Bezug auf Förderungsbedingungen notwendig seien, werde man in den nächsten Monaten diskutieren, hieß es vonseiten des Staatssekretariats.
Druck von oben hält auch Daniel Sanin für sinnvoll. Aber, wie der Fall Weinstein gelehrt hat, braucht es konkrete Namen: „Wir als Anlaufstelle kennen sie, es wäre aber wünschenswert, wenn öffentlich Namen fallen würden. Wenn eine alleine etwas sagt, lastet das volle Risiko auf ihr. Wenn zehn Frauen sich trauen, hat das gleich ein anderes Gewicht.“




Kommentare