Kleber auf Dino, Blut auf Clown: Kein Ende von Störaktionen in Museen

Die Suppendosen überschlagen sich: Am Montag wurde bekannt, dass im Pariser Musée d'Orsay bereits am vergangenen Donnerstag eine Attacke auf zwei Kunstwerke in letzter Minute verhindert wurde. Eine Frau wollte dort laut der Zeitung Le Parisien ihr Gesicht an ein berühmtes Selbstporträt Vincent Van Goghs kleben und ein Bild von Paul Gauguin mit Suppe bewerfen. In Berlin ist die Polizei am Sonntag zu gleich zwei Störaktionen in Museen gerufen worden. In der Alten Nationalgalerie hatte eine Person das verglaste Gemälde „Clown“ von Henri de Toulouse-Lautrec und die dortige Wandbespannung mit einer Kunstblutflüssigkeit beworfen und sich an die Wand neben das Gemälde geklebt. Im Museum für Naturkunde klebten sich zwei Klimaaktivistinnen an den Haltestangen eines Dinosaurierskeletts fest.
Auch Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz verurteilte am Montag die Aktionen scharf. Am vergangenen Donnerstag waren in Den Haag drei Aktivisten nach einer Attacke auf das Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ von Johannes Vermeer festgenommen worden.
Erdäpfelpürree-Attacke auf Monet-Gemälde
Die Attacke auf das Bild Toulouse-Lautrecs konnte zunächst keiner konkreten Aktivistengruppe zugeordnet werden - laut Polizei hatte die agierende Einzelperson für mehr Demokratie demonstrieren wollen und im Saal auch Flugblätter verteilt. Zu der Dino-Aktion in Berlin äußerte sich die Protestgruppe „Letzte Generation“ - sie hatte zuletzt die Erdäpfelpürree-Attacke auf das Monet-Gemälde "Heuschober" im Museum Barberini Potsdam zu verantworten. „So wie den Dinosauriern damals drohen uns Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können. Wenn wir uns nicht mit dem Aussterben bedroht sehen wollen, müssen wir jetzt handeln.“
Dass Dinosaurier nach breiter wissenschaftlicher Übereinkunft nicht durch selbst verschuldeten Klimawandel, sondern durch einen Meteoriteneinschlag ausstarben, hinderte die Gruppe, die anderswo sehr wohl ihre Unterstützung der Wissenschaft bekundet, nicht an dieser Argumentation.
Diskurs unmöglich
Gegenüber den Kulturinstitutionen bestehe aktuell "keine Gesprächsbereitschaft" seitens der Aktivistinnen, befand Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Wiener Albertina, im Ö1-Mittagsjournal am Montag. Er habe "in dieser Phase der Eskalation" vermieden, mit Aktivisten direkt ins Gespräch zu kommen: "Wir müssen in der gesamten Öffentlichkeit ein Umdenken herbeiführen".
Schröder bekräftigte darüber hinaus einmal mehr, dass Museen eigentlich "natürliche Verbündete" jener Kräfte seien, die rasches Vorgehen zur Eindämmung des Klimawandels und dessen katastrophaler Folgen fordern. "Wir sind geradezu konditioniert, dass wir Kunstwerke über Jahrhunderte bewahren und schützen wollen. Attacken gegen Kunst werden in diesem Fall nicht helfen."
In den vergangenen Tagen hatten sich mehrere Stimmen aus den Museen gemeldet, um zu bekräftigen, dass der Klimaschutz auch ein Anliegen jener ist, die sich um den Schutz von Kunst und Kultur bemühen. "Als Restauratorinnen und Restauratoren sehen wir bereits seit Jahrzehnten, wie sich die Erderwärmung negativ auf unser Kulturerbe auswirkt", erklärte der deutsche Verband der Restauratoren (VDR). "Mit den Aktionen, mit denen die Klimaaktivisten möglichst große Beachtung in den Medien erreichen wollen – und dies auch tun – arbeiten die Aktivist:innen somit gegen einen möglichen Partner: die Restaurator:innen."

Glas macht Aktionen nicht harmloser
Der deutsche Verband der Restauratoren wies auch darauf hin, dass es ein Irrtum sei zu denken, ein Glasschutz vor einem Kunstwerk würde dieses automatisch vor Beschädigung schützen. "Dazu muss man wissen, das Verglasungen nicht zwangsläufig komplett dicht sind, Flüssigkeiten in die Ritzen eindringen und mit dem Bildträger und den Malschichten in Berührung kommen können.
Auch die Rahmen sind wertvoll, vor allem wenn sie aus der Zeit des Kunstwerks selbst stammen sind sie wichtiger Bestandteil des Werks. Bei unverglasten Gemälden würden die Schäden gewiss weitaus gravierender ausfallen, wobei das Ausmaß der Beschädigung sehr von der Zusammensetzung des Kunstwerkes – Ölgemälde oder ein anderes Malmedium – und auch der Art der Substanz, die auf die Oberfläche trifft, abhängt."
Filz rettete Monet
Im Fall des Monet-Gemäldes im Barberini-Museum Potsdam - nach vorübergehender Schließung öffnete das Haus am Montag wieder seine Tore - hatte etwa nicht der Glassturz, sondern ein Stück Filz, das bei der Rahmung zwischen Glas und Gemälde gelegt wurde, das Schlimmste verhindert, wie die zuständige Restauratorin in der Süddeutschen Zeitung schilderte. Wäre die Breisuppe mit der Leinwand in Berührung gekommen, wäre die Feuchtigkeit in ihr hochgezogen, hätte das Leinen sich ausgedehnt, wäre in Bewegung geraten.
Auch "Kollateralschäden" auf benachbarten Gemälde und Museumsobjekten sind bei Schütt-Aktionen nicht auszuschließen, nicht jedes Gemälde hat einen Glassturz. Im New Yorker Museum of Modern Art sei etwa nur die "Sternennacht" von Vincent van Gogh derart geschützt, erklärte Schröder auf Ö1 - die Preziose würde auch ständig bewacht. Doch im Museumsbetrieb, der das kulturelle Erbe einerseits schützen und andererseits so barrierefrei wie möglich zugänglich machen will, sei derlei nicht durchgehend möglich: "Man kann nicht vor jedes Kunstwerk zwei Personen stellen.“


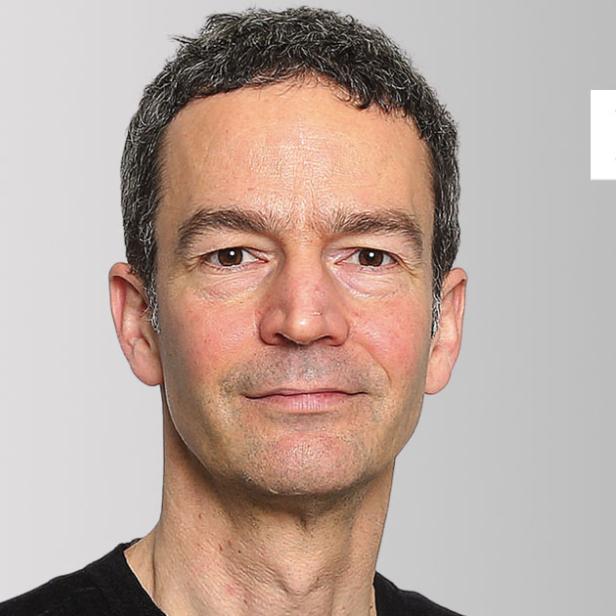

Kommentare