Kabarettistin Lisa Eckhart: "Was soll ich da Bestürzung mimen?"

Man möchte schreiben: Lisa Eckhart polarisiert. Aber das ist viel zu banal.
Die Kunstfigur spielt ein Kunstspiel mit Rechts und Links und Fressen und Moral. Wer sich moralisch verfolgt fühlt, wer sich in dem, was er sagen darf oder worüber er lachen darf, eingeschränkt fühlt: Lisa Eckhart erledigt das auf der Bühne für ihn.
Sie sticht in den Kulturkampf um die Grenzen des Sagbaren hinein. Und zündet eine der Empörungsminen nach der anderen.
Und wähnt so die, die politische Korrektheit beklagen, bei sich in (wohl auch vergifteter) Sicherheit.
Über dieses Kabarett kann man trefflich streiten. Und dieses Sprechen jenseits von Gut und Böse fordert Urteile heraus. Eine Grenze wurde für viele mit einer Pointe überschritten, die sie über die jüdische Männerriege der #MeToo-Bewegung machte: „Jetzt plötzlich kommt raus, denen geht’s wirklich nicht ums Geld, denen geht’s um die Weiber, und deswegen brauchen sie das Geld.“
Es folgten Antisemitismus-Vorwurf und Shitstorm.
Nun wurde Eckhart von einem Literaturfestival ausgeladen – und seither hart kritisiert und willig verteidigt, an Schlagwörtern wie Kunstfreiheit und Zensur entlang.
Am Montag erscheint Eckharts Debütroman, „Omama“. Ist das eine harte Woche? Oder ein voller Erfolg?
Der KURIER klinkte sich in den Interviewreigen ein. Zum Auftakt eine Frage, die hinter die Kunstfigur führen soll.
KURIER: Wie geht es Ihnen?
Lisa Eckhart: Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das gefragt werde. Aber auch eine Frage, die ich mir sehr selten stelle. Ich gebe nicht viel auch auf meine eigenen Gefühle. Aber ich denke, es geht mir gut. Ich bin gesund und bei Trost.
Ich frage, weil vieles passiert ist, das doch unangenehm sein muss für eine Figur, die so viel Wert auf Distanz legt. Lisa Eckhart wird von allen umarmt und vereinnahmt. Über sie wird eine Diskussion über Cancel Culture (Versuch, Unliebsame online zu „löschen“, Anm.) geführt.
Es gibt Teile, die mit Sicherheit unangenehm sind. Aber auch Diskussionen, die sehr wohl geführt werden können. Wenn man sich anspruchsvoll über Cancel Culture und politische Korrektheit unterhielte, fände ich das sehr interessant. Es an meiner Person oder an so einer Lappalie wie einer Ausladung festzumachen, ist vergleichsweise uninteressant.

Ich würde sagen: Die Cancel Culture wird gerne überbewertet, wenn es einem passt. Es könnte nicht egaler sein, was im Internet gesagt wird.
Ich empfinde das schon als problematisch. Das Digitale gleicht ja in der Form einer Intimsphäre, und das führt natürlich zu Über- und Untergriffigkeiten ungeahnten Ausmaßes.
Und jetzt?
Ich möchte nicht missionieren und sagen: Wir kappen jetzt das Internet. Aber es ist schon etwas anderes, dass jeder Mensch Zugang zu Öffentlichkeit hat. Und auch sehr fahrlässig mit Schrift umgeht. Wenn ich sehe, mit welch einer Nonchalance die Menschen im Internet wild drauf los schreiben, dann stellt sich mir die Frage, ob wir wirklich alle alphabetisieren sollten (lacht). Oder vorher nachschauen, ob sie sich menschlich als würdig erwiesen haben, mit diesem Geschenk und Privileg umgehen zu können.
Man kann das alles auch einfach nicht lesen.
Das tue ich auch tatsächlich nicht. Nur stürzen sich dann doch manche eigentlich mit Autorität ausgestattete Blätter wirklich auf dieses Geschrei. Was ich nicht verstehe. Man wäre doch als Journalist niemals in den Wiener Narrenturm gegangen, um sich zu erkundigen, was halten Sie von Lisa Eckhart? Aber genau das tut man, wenn man sich auf Twitter begibt und dort irgendeinem Shitstorm hinterher schreibt.
Aber die Diskussion über die Pointe, die den Shitstorm ausgelöst hat, ist doch keine x-beliebige Political- Correctness-Debatte, sondern hat einen für dieses Land ganz wichtigen Kern. Nämlich ob und wann dieser schwierige Umgang, den wir mit der Vergangenheit hatten, jetzt beendet ist oder von wem der beendet werden darf. Das rührt ans Österreichische.
Ja, aber auch ans Deutsche. Das ist kein Thema, das abgeschlossen wäre. Ich finde interessant, wie die Menschen damit umgehen. Da gibt’s die einen, die sagen: Man möge uns jetzt in Ruhe lassen damit, das ist schon so lange her. Und zum anderen die, die so tun, als hätten sie etwas aufgearbeitet. Und glauben, dass in dieser kurzen Zeit eine moralische Besserung des Menschen vonstattengegangen wäre. Da denke ich mir: Wie kommt ihr darauf? Es gibt den Menschen seit 30.000 Jahren. Aber erst im letzten Jahrhundert haben wir uns, natürlich unter Mithilfe der Technik, die größten Debakel geliefert. Man ist noch lange nicht am Ende mit der Denkarbeit zum Menschen, seiner Fähigkeit zu Gräueln und der Banalität des Bösen.
Aber verstehen Sie, warum man von dieser Pointe entsetzt war?
Nein. Beim besten Willen. Dazu kann ich mich nicht durchringen. Aber natürlich, es hat nicht sofort Trotz eingesetzt, sondern ich bin das nochmal durchgegangen. Ich musste dann aber wohl oder übel zugeben, dass ich recht hatte. Die Nummer ist brisant. Und die Nummer sollte empören. Aber nicht die, die sich dann empört haben, und nicht aus diesen Gründen.
Sondern?
Das Ziel war ein ganz anderes. Es war gerichtet gegen den Furor der damaligen #MeToo-Bewegung, die auf jede strafrechtlichen Grundsätze gepfiffen hat. Man hat mit einer Heiterkeit auf Menschen eingeschlagen, wo ich mir dachte, den Spaß vergälle ich euch jetzt. Denn plötzlich hat sexuelle Belästigung den Antisemitismus von der Poleposition der gesellschaftlichen Vergehen gekickt. Ich war verwundert. Diese Menschen waren allesamt Vertreter dessen, was man sonst eine schützenswerte Minderheit genannt hätte. Das wollte ich der #MeToo-Bewegung vorwerfen. Dass das dann so pervers verkehrt wurde – da saß ich staunend davor.

Aber wenn man ein paar Monate später von der AfD vereinnahmt wird, kommt man dann nicht doch ins Grübeln, ob man ein paar Signale zu wenig gesetzt hat, dass hier Lesehilfe nötig wäre?
Nein, keineswegs. Ich bin ja nicht die erste Satirikerin, der das widerfährt. Diese Menschen sind – das wissen wir, viele Kabarettisten behandeln das unentwegt – völlig ungenierte Opportunisten. Was soll ich da Bestürzung mimen? Ich hätte keinen großen Anlass gesehen, mich davon zu distanzieren. Ich bin davon Welten entfernt. Ich möchte diese Menschen eigentlich nicht mal mit Negativwerbung bedenken.
Am Montag erscheint nun Ihr Debütroman. Hält das Buch diese Debatte aus?
Locker!
Marcel Reich-Ranicki hat immer im Anzug gelesen. Man stellt sich vor: Sie schreiben auch nicht in der Jogginghose.
In der Unterwäsche. Reich-Ranicki hat das gemacht, um dem Autor seinen Respekt zu erweisen. Das tue ich in Dessous aber auch.
Auf den ersten Seiten begegnet man gleich einem längeren Stück über ein Mädchen, das sich grämt, dass die russischen Besatzungssoldaten nicht gleich über sie herfallen. In welchem Gemütszustand schreibt man denn so etwas?
Ich muss ausreichend abgeschottet sein. Es ist in zwei Sommern entstanden, da schreibe ich dann rund um die Uhr. Leider zwingt mich das Kreatürliche doch zum Schlafen. Aber ansonsten bin ich zum Glück von jeglichen Hobbys verschont. Demnach konnte ich da zwei Mal zwei Monate von morgens bis spätnachts durchschreiben. Das war höchst beglückend.
Als Rezensent könnte man sich da reichhaltig bedienen an allerlei grellen Formulierungen: Das Schnitzel ist wie ein Jungfernhäutchen, die Creme riecht wie „Neger“.
Wer das bösartig lesen will oder sich von diesem Flirren ablenken lassen will, dem kann ich nicht helfen. Aber es gibt viele, die dieses Wechselbad aus dem Derben und dem Erhabenen schätzen. Beides kann gut und gerne unter der Gürtellinie sein.

Es scheint da jedenfalls kein Problem damit zu geben, dass man etwas nicht sagen oder schreiben darf. Die von Ihnen auch thematisierten Einschränkungen durch die Political Correctness, dass man vieles nicht mehr sagen dürfe: Das Buch zeigt ja, dass es das nicht gibt. Die Grenzen des Sagbaren sind Scheunentore, durch die man alles durchrufen kann.
Ja! Aber nur für mich. Das gestehe ich doch anderen nicht zu. Die Kunst genießt Narrenfreiheit. Und damit auch ich als ihr bescheidenes Medium. Ich bin keinesfalls dafür, dass jeder die Grenzen des Sagbaren ausweitet. Das ist ein Privileg, das die Kunst hat, weil es auch ihre Aufgabe ist. Die anderen sollen es gefälligst wieder eingrenzen. Ich bin nicht dafür, dass die Kunst als Gegenreaktion versucht, die Grenzen für sich einzuengen, weil sie sieht, wie unsäglich die anderen ausweiten. Ich werde das Volk höflich bitten, sich wieder etwas zusammenzureißen und Grenzen wieder aufzurichten. Damit ich gefälligst wieder was zum Überschreiten habe. Ich war immer eine Verfechterin des Abstands. Aus Respekt. Und nicht, so wie jetzt, aus Angst vor dem anderen.
Bei Ihnen wünscht man sich immer eine Art Erklärung. Also: Was wollen Sie denn mit dem Buch?
Um Himmels Willen! Ich habe befürchtet, dass das Deutschlehrer in 70 Jahren fragen. Dass Sie jetzt schon damit kommen, ist so eine Dreistigkeit, dass es schon fast wieder charmant ist. (lacht)
Und?
Ich kann die Frage nicht beantworten. Ohne zu kokettieren. Ich kann es nicht. Ich maße mir nicht an, ich mache Kunst. Das ist das Ziel, dem nähere ich mich an. Das ist ein sehr devotes Streben. Aber selbst das setzt schon voraus, dass ich mich völlig frei mache von einer kabarettistischen Pret-a-Porter-Haltung und stumpfen Botschaften to go.
Die „Omama“ ist eine Frau, wie es halt ist. Mit Darmwinden und Vorurteilen. Das ist weit liebevoller gemacht gegenüber den Menschen als die Bühnenprogramme. Ist das vielleicht sogar verkappter Humanismus?
Ja. Das haben Sie sehr gut erkannt. Das bleibt jetzt aber unter uns – was Sie natürlich schreiben werden (lacht): Alles – meine Bühnenprogramme vielleicht nicht so offensichtlich – trieft vor Philanthropie. Auch Nietzsche hatte hart zu kämpfen gegen seine Menschenliebe. Das Buch ist sehr liebevoll. Die kokette Frage am Anfang – ist es Rufmord oder ist es Hommage? Für mich war das völlig klar.
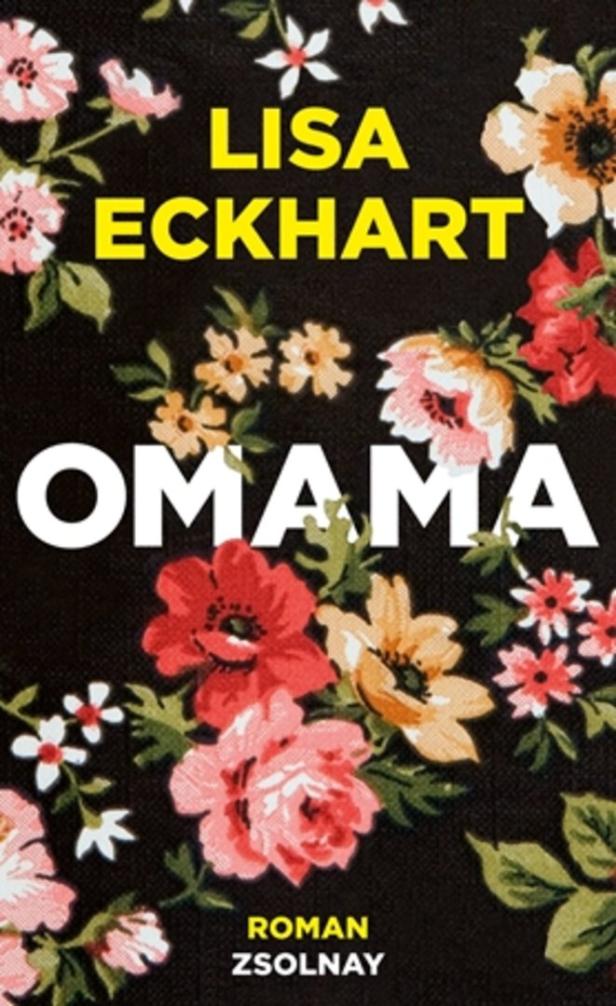


Kommentare