Ewige Hassliebe zum Westen

Menschenrechte, moderne Verwaltung, europäisches Schulwesen: Katharina die Große wollte das verwirklichen, wovon schon viele Zaren vor ihr geträumt hatten – und viele Zaren nach ihr. So wie die Deutsche auf dem Zarenthron sollten unzählige Herrscher im Moskauer Kreml an dieser Vision scheitern: Russland als Teil Europas, als europäisches Kaiserreich an der Seite all der anderen Reiche, die man insgeheim bewunderte und beneidete.
Doch Neid und Bewunderung, das ist nur die eine Seite der Geschichte, die von Russlands Verhältnis zum Westen erzählt. Die andere – und die lässt sich ebenso bis ins Mittelalter zurückverfolgen – erzählt von der tiefen Überzeugung, anders, weit entfernt und nicht zuletzt moralisch überlegen zu sein. Ob Peter der Große oder der letzte Zar, Nikolaus II., sie kopierten westliche Hofhaltung und Führungsstil, sahen sich aber in der göttlichen Bestimmung, die ihnen das Zarentum auferlegt hatte, als die Vertreter einer reinen Lehre. Es ist diese russische Schizophrenie, die man heute bei Wladimir Putin beobachten kann, der seinen Krieg in der Ukraine mit Attacken gegen den Westen begleitet. Dieser Westen sei in Dekadenz und Gottlosigkeit versunken – und für Russland eine Existenzbedrohung, militärisch und moralisch.
Dieser schnörkellose Zug aus den Tiefen der russischen Geschichte bis in die Gegenwart ist das, was Galeottis kurze Geschichte so spannend macht. Es ist ein müheloser Spaziergang durch ein Jahrtausend, immer entlang der großen Leitmotive der Geschichte dieses Riesenlandes, der so viele ihrer Geheimnisse lüftet.
Wenn Galeotti die Machtstrukturen Russlands bis zurück in die Tage der Mongolenherrschaft zurückverfolgt, wird klar, warum dieses Land sich so hartnäckig jeder Reform widersetzt. In den Bojaren, also den Großgrundbesitzern, an deren Macht die Reformideen etwa Katharinas der Großen zerschellten, erkennt man als Leser unschwer die Oligarchen des heutigen Russland, die ihre Positionen mit Zähnen und Klauen verteidigen. Der Zar aber konnte (und kann) auf sie als Geldgeber nicht verzichten und musste ihre Privilegien unangetastet lassen.
Nicht nur in diesem Scheitern erkennt man Putins heutige Rolle auf bestechende Weise wieder, auch in seinem Anspruch, in Russland nach dem Chaos der Jelzin-Jahre wieder Ordnung geschaffen zu haben. Das Land aus einer „Zeit der Wirren“ herausgeführt zu haben, diese Rolle hatten einst schon die Zaren aus der Dynastie der Romanows für sich beansprucht.
Was sie damit rechtfertigten? Genau die Stärkung der Zentralgewalt im Kreml in Moskau: jene harte Hand also, ohne die – so hört man von Russlands Herrschern bis heute – das Land ohnehin nicht zu regieren wäre.
Das gilt auch für die Machthaber, die eigentlich die völlige Umkehr der herrschenden Verhältnisse, die Revolution auf ihre Fahnen geheftet hatten: die Bolschewiken. Doch die Akteure dieser Revolution, die eigentlich ein Putsch war, bedienten sich der gleichen Strategien wie alle Herrscher Russlands: die Macht im Kreml, die Privilegien für die Gutsherren draußen in den Weiten des Reiches – auch wenn die jetzt nicht mehr Bojaren, sondern Kommissare hießen.
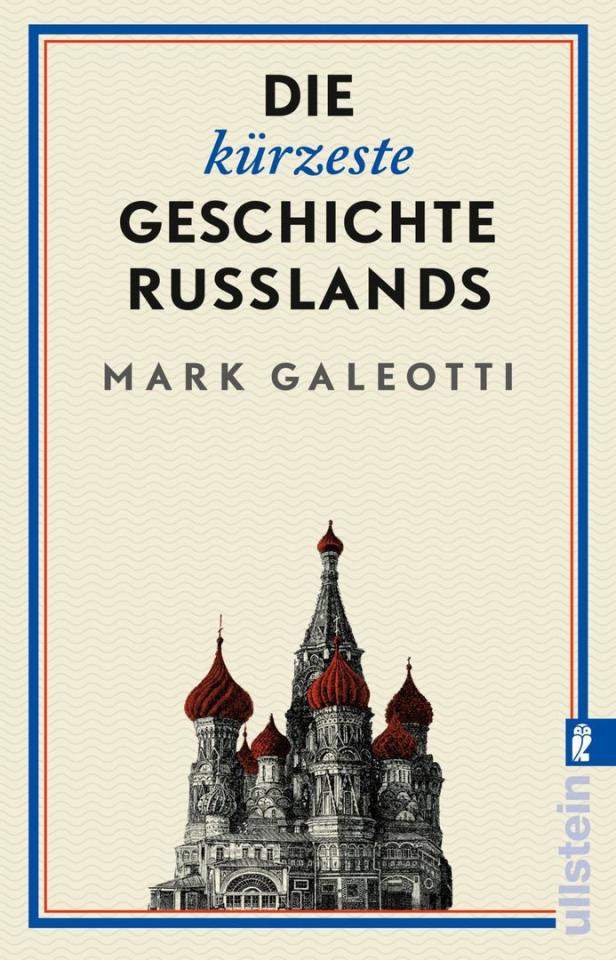
Mark Galeotti: „Die kürzeste Geschichte Russlands“, Ullstein, 256 Seiten, 14 €
Kommentare