Rachel Cusk: Das Ich und der andere

Was ist Kunst? Was ist Leben? Und welche Rolle spielt die sogenannte Wirklichkeit? In mehreren auf den ersten Blick nicht zusammenhängenden Erzählungen greift die aus Kanada gebürtige, in Paris lebende Schriftstellerin Rachel Cusk dieses Thema in Varianten auf. In jeder Geschichte geht es um Künstler und ihre Entourage: Galeristen, Museumsdirektorinnen, aber auch Eltern, Kinder, Partner. Schauplatz ist Europa, konkret genannt wird einmal Italien.
Die titelgebende „Parade“ erzählt von einer Museumsdirektorin, die den Selbstmord eines Musemsbesuchers miterlebt hat. Kurz zuvor hat er sich die Ausstellung angeschaut. Hat ihn die Kunst zu diesem radikalen Schritt bewegt?
„Die Stuntfrau“ berichtet von einem Maler, der plötzlich verkehrt herum malt. Niemand fragt, ob er tatsächlich eine auf den Kopf gestellte Welt abgemalt oder die Bilder nach dem Malen einfach umgedreht und signiert hat. Aber er hat großen Erfolg. Mit einem Porträt der eigenen Frau zum Beispiel, das besonders hässlich gerät. Sie ist schockiert, hält ihn aber für ein Genie. Und stellt sich natürlich die Frage: Sehe ich so aus? Immer wieder taucht hier die Spiegelmetapher auf: Die beunruhigende Erkenntnis, dass wir nicht so aussehen wie im Spiegel, dass uns das Gegenüber anders sieht, als wir uns selbst sehen.
Cusk arbeitet sich am Thema „Das Ich ist ein anderer“ und der Frage nach Wahrnehmung, der Essenz künstlerischen Schaffens, ab. Das ist stellenweise sehr gelungen, stellenweise etwas gar psychotherapeutisch. Unterstrichen wird das auch sprachlich durch abrupte Perspektivenwechsel: Was mit einem Bericht in dritter Person beginnt, wird plötzlich zum selbsterlebten „Wir“. Erschwerend kommt dazu, dass die meisten Künstler und Künstlerinnen, die hier vorkommen, G. heißen.
Großartig ist dieses Buch in seiner messerscharfen Beobachtung der Kunstwelt, die manchmal satirische Anwandlungen hat. Auch in der Frage, ob sich Künstlerdasein mit Familienleben vereinbaren lässt. Und ob sich nicht der Partner, der mit schnöder geregelter Lohnarbeit für den Lebensunterhalt sorgt, hin und wieder fragt, warum sich nur der andere mit Lyrik, die „keiner liest“, „selbstverwirklichen“ darf.
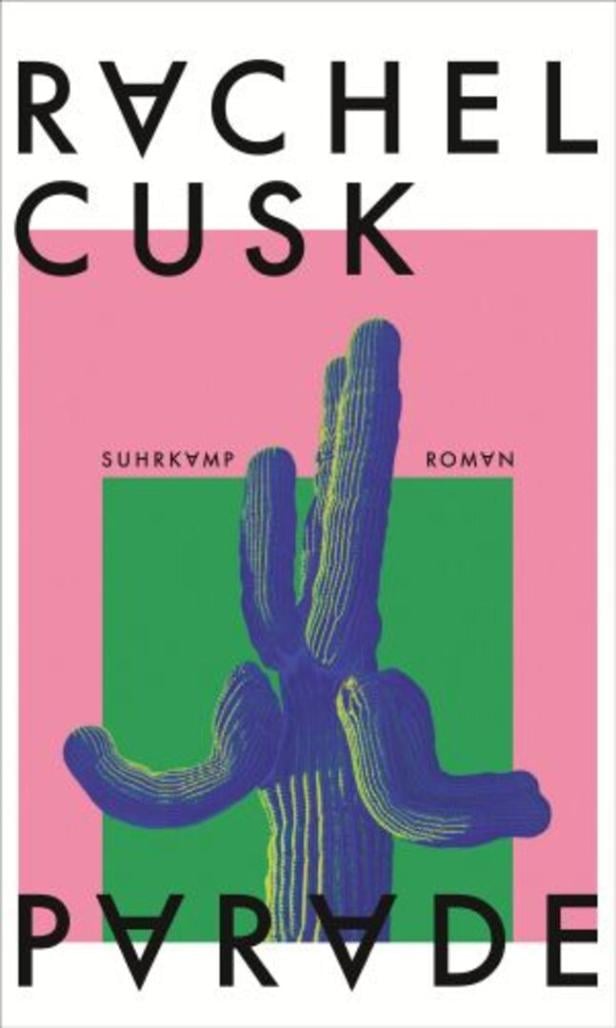
Rachel Cusk: „Parade“, übersetzt von Eva Bonné. Suhrkamp. 171 Seiten. 26,50 Euro
