Didier Eribon: Wunschloses Unglück

Eigenständig leben geht nicht mehr. Die Feuerwehr stellt das regelmäßige Türaufbrechen und die „Aufstehhilfe nach Sturz“ in Rechnung. Ins Pflegeheim will die Mutter nicht. Und sagt doch bald die furchtbaren Sätze: „Du hast recht, ich muss vernünftig sein.“
Der Soziologe Didier Eribon widmet sich in „Eine Arbeiterin“ wieder seiner Herkunft, der französischen Arbeiterklasse. Seine Mutter war ihr Leben lang unglücklich. Litt unter Armut, dem brutalen Vater, starb an einem Ort, der nicht ihr Zuhause war. Wer ist „schuld“? Die „Ordnung der Welt“: „Die Unausweichlichkeit des Älterwerdens, die Folgen der schweren körperlichen Arbeit und der damit einhergehenden Lebensbedingungen, die Realität moderner Familienstrukturen (...), der gesellschaftliche und politische Umgang mit Alter, Krankheit, Hilfsbedürftigkeit.“
Soziologisch analysierend und persönlich erinnernd zugleich – aus den Seiten eines Dialekt-Wörterbuchs hallt ihm die Stimme der Mutter entgegen, –, erzählt Eribon von der Mutter, prangert das französische Sozialsystem an und zitiert viele andere Autoren (u. a. sich selbst). In seiner Verteidigung der Arbeiterklasse geht es erneut auch um Abgrenzung zu ebendieser. Zum „typischen Geschmack der Arbeiterklasse“, zum schlichten Bruder, zu denen, die nicht bei den „Ausländern“ wohnen wollen. Er, Eribon, schwul, intellektuell, in Paris lebend, ist das, was die Arbeiterklasse angeblich so hasst. So hat er es erlebt. Weiß man aus früheren Büchern. Manches hier ist berührend. Und einiges wehleidig. Der Anblick der alten, nackten, hilflosen Mutter ist ihm „nahezu unerträglich.“ Lieber liest er Norbert Elias „Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen“. BB
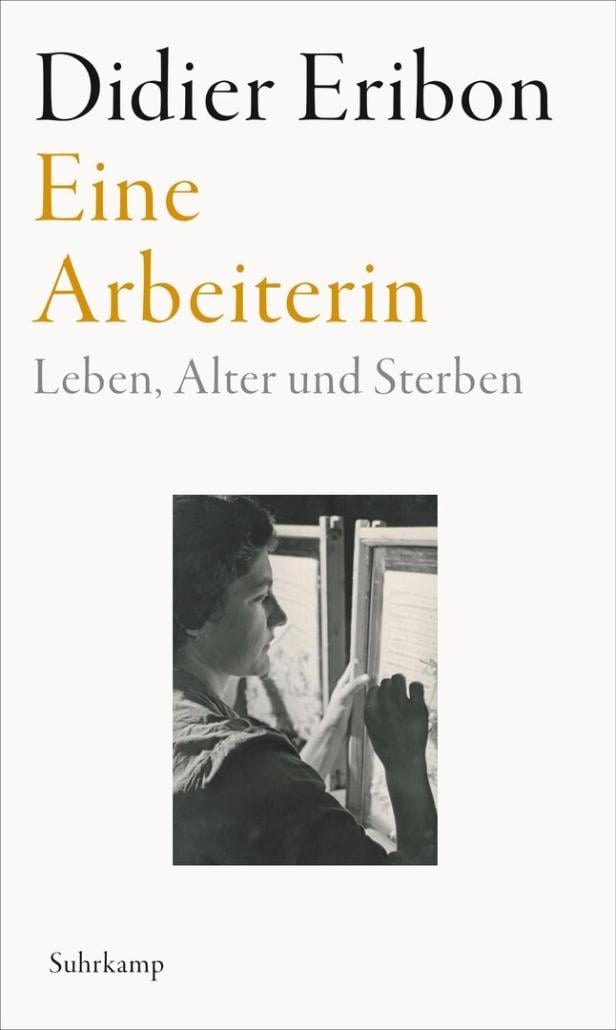
Didier Eribon:
"Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben."
Übersetzung: Sonja Finck
Suhrkamp
240 Seiten, 25,70 Euro
