Wie man Schmerzen bei Demenzkranken besser erkennt

Wenn Demenzpatienten zu essen aufhören, unruhig oder aggressiv werden, muss das kein Symptom ihrer Erkrankung sein. Häufig wird die Veränderung aber als solches interpretiert – und falsch behandelt.
Mit der steigenden Zahl an Demenzkranken rückt das Thema Schmerz in dieser Patientengruppe in den Fokus von Schmerzmedizinern.
„Demenzkranke können sich oft nicht mehr selbst helfen und auch Schmerz schlechter ausdrücken. Wenn wir nicht wissen, dass der Patient Schmerzen hat, können wir ihn auch nicht adäquat therapieren“, erklärt Prim. Nenad Mitrovic, Vizepräsident der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG) die Problematik.
Verhaltensauffällig
Schmerz gilt als wichtigste Ursache für neuropsychiatrische Symptome, sagt Gabriele Grögl-Aringer, Präsidentin der ÖSG und Leiterin der Schmerzambulanz in der Rudolfsstiftung. Anders ausgedrückt: Da die Betroffenen ihre Schmerzen nicht mehr verbal äußern können, reagieren sie mit Verhaltensauffälligkeiten.
Wie die eingangs erwähnte Unruhe, aber auch mit Aggression, Apathie, Depression, Halluzinationen oder Rückzugstendenzen.
Die Folgen dieser Artikulierungsschwächen zeigen mittlerweile bereits klinische Studien: Demenzpatienten erhielten etwa bei vergleichbaren Erkrankungen weniger Schmerzmittel als Patienten, deren Gedächtnisleistung nicht eingeschränkt war.

Unterschiede auch bei operativen Eingriffen
Mitrovic nennt ebenso operative Eingriffe, etwa Hüftgelenke: „Wir wissen aus Untersuchungen, dass Demenzkranke um ein Drittel weniger Morphin-Dosen bekommen, als andere Patienten.“
Vergleichsergebnisse liegen auch bei gängigen Schmerzmitteln wie Paracetamol vor. „Hier erhielten Demenzkranke eine um 50 Prozent geringere Dosis im Vergleich zu Schmerzpatienten ohne Demenz.“
Je älter, desto sind häufiger Schmerzsyndrome
Schmerz tritt mit zunehmendem Alter generell häufiger auf. Ebenso steigt die Anzahl der Demenzkranken mit zunehmendem Alter – von 130.000 Betroffenen derzeit in Österreich auf doppelt so viele im Jahr 2050. Etwa jeder zweite ältere Mensch dürfte unter zum Teil chronischen Schmerzen und Demenzerkrankungen leiden.
„Schon aus diesen Gründen verdient diese Gruppe in unserer immer älter werdenden Gesellschaft Beachtung“, betont Grögl im Rahmen der 18. Schmerzwochen (Infos: www.oesg.at). Leider werden Patienten häufig nur „ruhiggestellt“, weil der Schmerz nicht erkannt wird. „Das ist nicht optimal und verbessert die Demenzsymptome nicht“, betont Mitrovic.
Schmerzskala
Wie findet man nun aber heraus, ob ein Demenzpatient Schmerzen hat? „Wenn sich der Patient nicht mehr artikulieren kann, müssen wir als Ärzte und Betreuer aktiv auf ihn zugehen“, erklärt Mitrovic. Eine wesentliche Rolle komme dabei dem Pflegepersonal in Altersheimen und Hospizen zu.
Die Instrumente dafür gibt es bereits. Eine dieser Methoden, die in den vergangenen 20 Jahren entwickelt wurden, ist die sogenannte BESD-Skala (Beurteilung von Schmerz bei Demenz).
Bei leichter Demenz können bereits einfache Fragen ausreichen, bei schwerer Demenz wird der Zustand nach einem international entwickelten Punktesystem eingeordnet.

Mimik, Reaktion
„Man beachtet dabei unter anderem Mimik, Körperstellung, Atmung oder die Reaktion auf Trost“, erklärt Mitrovic. „Je höher die Punkteanzahl, desto größer ist die Möglichkeit, dass der Demenzkranke unter Schmerzen leidet.“
Im Zweifelsfall sei ein „vorsichtiger Therapieversuch mit Schmerzmitteln“ gerechtfertigt. „Doch wie bei allen Schmerzpatienten können auch nichtmedikamentöse Maßnahmen wie Musiktherapie oder mehr persönliche Zuwendung die Lebenssituation verbessern.“
Gefährdet: Säuglinge, Suchtkranke, Migranten
Außer Demenzkranken widmet sich die Schmerzgesellschaft im Rahmen der Schmerzwochen noch weiteren Personengruppen, die gefährdet sind, dass ihre Schmerzen übersehen oder falsch eingeschätzt werden. „Dazu zählen alle, die nicht oder nicht ausreichend für sich sprechen und eine Schmerztherapie einfordern können“, erklärt Präsidentin Gabriele Grögl-Aringer.
In diese Gruppe fallen etwa Säuglinge. „Die Behandlung von Schmerzen bei Frauen während der Schwangerschaft, der Geburtsperiode und der Stillzeit ist oftmals mit Unsicherheit und Ängsten wegen einer möglichen Schädigung des Babys verbunden“, betont Grögl-Aringer. Die Schmerzmediziner wollen Informationsdefizite beheben und die Empfehlungen der involvierten ärztlichen Fachgruppen bündeln.
Suchtpatienten wenig beachtet
Eine wenig beachtete Gruppe sind Suchtpatienten, die entweder Opioide konsumieren oder in einem Substitutionsprogramm sind. Diese werden Dank der Therapien älter – und haben mit neuen Problemen zu kämpfen, sagt Wolfgang Jaksch vom Wiener Wilhelminenspital. „Durch die Ersatztherapie haben sie häufiger, intensiver und früher Schmerzen als Gesunde.“ Leider würden klare Empfehlungen fehlen. Jaksch fordert eine strukturierte Kooperation zwischen Sucht- und Schmerzmedizinern.
Migranten: Persönliche Situation ausschlaggebend
Wo viele Migranten leben, sind auch ihre Schmerzen ein Thema für Ärzte. Jene, die unfreiwillig ihre Heimat verlassen, belastet eine schlechte Integration, weiß Jaksch. „Das wirkt auch schmerzfördernd.“ Studien zeigen, dass türkische Migranten der ersten Generation vier Mal öfter unter chronischen Kopfschmerzen leiden, als Migranten der zweiten Generation. Problematisch erweisen sich in der Schmerzmedizin weiters Sprachbarrieren. Jaksch fordert interkulturelle Teams und professionelle Dolmetschdienste in den Spitälern.
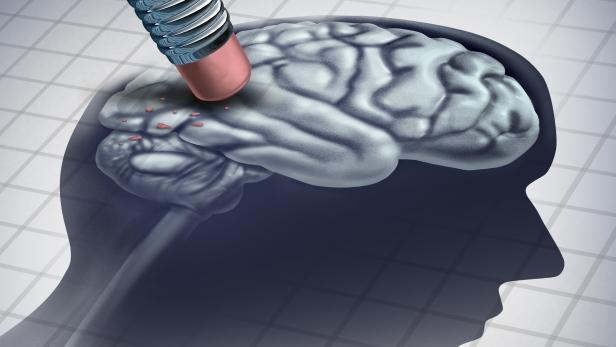

Kommentare