Vor Schulbeginn: Kinder und Jugendliche sind mental unter Druck
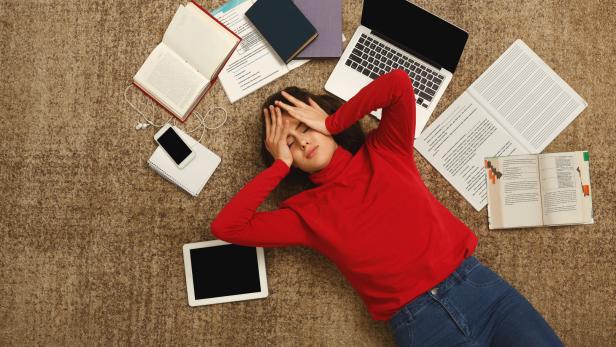
Erst vor wenigen Tagen wurde Nicole stationär in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen: Die 13-Jährige hatte – für ihre Eltern völlig überraschend – versucht, sich das Leben zu nehmen. Wie sich herausstellte, hatte das Mädchen schon seit fünf Monaten darüber nachgedacht. Als Gründe nannte sie depressive Gedanken und Schulängste durch Mobbing. Was nun angesichts des nahenden Schulbeginns in einer „zunehmenden emotionalen Verzweiflung“ gipfelte, sagt Kinderpsychiaterin Kathrin Sevecke, Präsidentin der Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Wir rechnen zu Schulbeginn mit mehr Fällen wie in diesem Beispiel.“
Psychische Belastungen haben angesichts von Pandemie und Krieg deutlich zugenommen, belegen Studien aus Österreich und der EU. „Sie betreffen mittlerweile jeden dritten Jugendlichen“, betont Sevecke. Neben Suizidgedanken, Angstsymptomen, Schlafstörungen tritt bei den jungen Menschen auch problematisches Konsumverhalten (etwa Süchte) auf. Der Beginn eines neuen Schuljahrs vergrößert nun die für viele der jungen Menschen ohnehin bereits große Herausforderung. „Schon vor der Pandemie galt Leistungsdruck in der Schule als belastend“, erklärt die klinische Psychologin Caroline Culen von der Plattform „Liga für Kinder- und Jugendgesundheit“.
Der gestiegene Bedarf durch die Pandemie hat die schon davor knappen Ressourcen nicht gerade verbessert: Rund 400 stationäre Plätze gibt es derzeit in Österreich für Kinder und Jugendliche. „Wir gehen davon aus, dass 800 nötig wären“, sagt Sevecke. Bei den Psychotherapien wären rund 85.000 kassenfinanzierte Plätze nötig, schätzt Barbara Haid, Präsidentin des Verbands für Psychotherapie. Derzeit dürften rund 17.000 junge Menschen in Behandlung sein. Die Wartezeiten sind lang, ein Ausbau wird schon seit Jahren gefordert. Er passiere zwar, aber auf zu niedrigem Niveau.
Zu lange Wartezeiten
Für Nicole, das Mädchen aus der eingangs zitierten Fallskizze, wäre nach der akuten Krisenintervention ein stationärer Aufenthalt angeraten gewesen. Aber: Aufgrund von Bettenknappheit wurde sie nach einer „gewissen Entlastung“, wie Sevecke sagt, bereits nach zwei Tagen entlassen. Ein stationärer Aufenthalt ist erst in sechs bis neun Monaten möglich. Ähnlich die Situation für die als Überbrückung empfohlenen Therapie bei einem niedergelassenen Facharzt: Wartezeit drei Monate für den Ersttermin. Und auch auf die ebenfalls empfohlene Psychotherapie muss die 13-Jährige mindestens sechs Monate warten.
Um zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche so tief in ihre Verzweiflung rutschen, dass sie keinen Ausweg mehr sehen, raten die Expertinnen zu möglichst frühem Gegensteuern. „Das Setting in der Schule als wichtige Lebenswelt junger Menschen ist besonders geeignet.“ Hier lasse sich Unterstützung gut integrieren.
Entstigmatisierung
Vor allem die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen sei extrem wichtig. Psychotherapeutin Haid regt an, das Thema „Mental Health“, also psychische Gesundheit, niederschwellig zu implementieren. „Es sollte selbstverständlich sein, dass man bei mentalen Problemen zu den Schulpsychologen geht, so wie man mit Kopf- oder Bauchschmerzen zu den Schulärzten geht.“ Die Zahl der Schulpsychologen müsse dafür ebenso aufgestockt werden, fordert Schülervertreterin Mira Lobnig, die die Initiative „Gut, und selbst?“ mitinitiierte. Derzeit kommen auf 1,1 Millionen Schüler 181 Schulpsychologen.
Das Thema sollte überhaupt im Stundenplan Platz finden, fordert Sevecke. „Mit einer Stunde pro Woche ließe sich ein Fach Psychische Gesundheit gut integrieren.“ Dabei könne auf bereits erarbeitete Präventionsprogramme zur Vermeidung von psychischem Stress und zur Aufklärung über psychische Erkrankungen zurückgegriffen werden.
Das sei eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Denn je niederschwelliger, desto eher verhindert man eine massive Verschlechterung. Es müssten allerdings derartige Angebote, etwa in den Schulen,, etwa in den Schulen, kommuniziert werden, vor allem unter den Jugendlichen salbst, betont Psychotherapeutin Haid. „Wenn ich glaube, es gibt für mein Bauchweh keine Hilfe, werde ich auch mit niemandem darüber reden.“
Kommentare