Wie ein Österreicher in den USA an Ersatzorganen forscht

Noch ist es ein weiter Weg bis zum ersten gezüchteten Organ, das einem Menschen – als Alternative zu einem Spenderorgan – eingesetzt werden kann: "Aber die Forscherinnen und Forscher in meinem Labor arbeiten intensiv daran, diesen Weg zu verkürzen", sagt der aus Tirol stammende Chirurg Harald C. Ott vom Massachusetts General Hospital in Boston, USA. Bei der Entwicklung biologischer Kunst-Herzen und Kunst-Lungen sind die Mitarbeiter des "Ott Lab" heuer entscheidende Schritte weitergekommen. Mit dem KURIER sprach Ott über diese Fortschritte – und den US-Wahlkampf.
KURIER: Wann könnte ein Mensch das erste, aus seinen eigenen Zellen gezüchtete Organ erhalten?
Harald Ott: Ich halte einen Zeitraum von zehn Jahren für realistisch – vielleicht können wir ihn auch abkürzen oder zumindest wesentlich dazu beitragen, dass es nicht länger dauert. Wir arbeiten jedenfalls hart daran, und es wird letztlich davon abhängen, welche Durchbrüche in den kommenden Jahren möglich sind. Patienten müssten dann jedenfalls nicht mehr wie derzeit oft jahrelang auf ein Spenderorgan warten – und sie bräuchten keine Medikamente mehr zur Unterdrückung des Immunsystems.
Wie funktioniert eine solche Organzüchtung?
Wir haben ein Verfahren entwickelt, das es möglich macht, mit einer speziellen Lösung ein Organ einer toten Ratte, eines toten Schweins aber auch eines verstorbenen Menschen von seinen Zellen komplett zu befreien. Übrig bleibt lediglich ein Gerüst aus Bindegewebe, aus Kollagen. Und dieses Gerüst besiedeln wir zum Beispiel mit Herzzellen des künftigen Organempfängers. Dadurch gibt es keine Abstoßungsreaktion mehr.
Wie können Sie diese Herzzellen gewinnen?
Das ist der Punkt, auf den wir derzeit den Schwerpunkt unserer Forschung richten: Wir nehmen zum Beispiel Hautzellen von Erwachsenen und versuchen, diese zu Stammzellen zurückzuentwickeln. Durch gezielte Stimulation wollen wir diese Vorläuferzellen anschließend dazu bringen, dass sie sich gezielt zum Beispiel zu Herzmuskel- oder Lungenzellen ausdifferenzieren, also weiterentwickeln. Und aus solchen Zellen wollen wir dann auf einem von den ursprünglichen Zellen befreiten Grundgerüst zum Beispiel eines Schweineorgans Herzmuskelgewebe wachsen lassen. Das würde uns von menschlichen Spenderorganen komplett unabhängig machen.
Wie weit ist das schon gelungen?
Wir konnten bereits aus Stammzellen Herzmuskelzellen züchten und diese sowohl auf einem Kollagengerüst eines ehemaligen Schweine- wie auch eines menschlichen Organs zu Gewebe entwickeln. Im Bioreaktor hat dieses Kunstherz dann einige Tage geschlagen, es gab auch eine elektrische Herzaktivität. Bei Lungen sind wir sogar noch etwas weiter: Lungengewebe, das wir ebenfalls aus menschlichen Stammzellen gewonnen haben, haben wir in einen Schweineorganismus eingebracht, und es hat eine Stunde lang funktioniert.
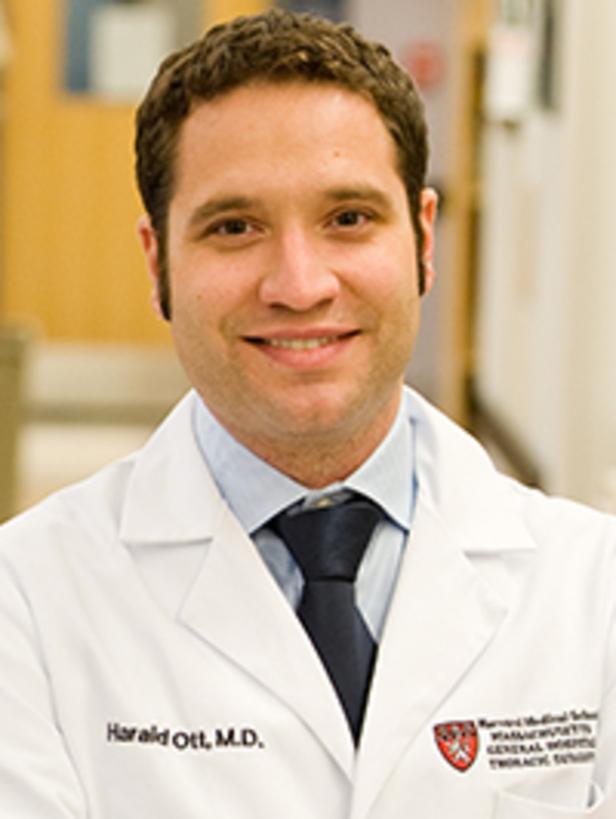
Sie sind österreichischer und US-Staatsbürger. Nehmen Sie an der Präsidentenwahl teil?
Ich habe schon gewählt, meine Entscheidung bleibt aber mein Wahlgeheimnis.
Wie haben Sie den Wahlkampf erlebt?
Wenn man es medizinisch ausdrückt: Wie eine Biopsie, eine Art Stichprobe oder auch wie ein Symptom, das die gesamte Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Entwicklung und die Frustration vieler Menschen aufzeigt. Der Wahlkampf hat uns allen – auch den politischen Repräsentanten – einen Spiegel vorgehalten. Auf der einen Seite hatte er einen gewissen Unterhaltungswert, aber letztlich war es besorgniserregend, wie er abgelaufen ist, fernab von den wirklich wichtigen Themen.
Welche sind das?
Das große Problem ist, dass die wirtschaftliche Erholung nach der Rezession nur sehr langsam vor sich geht und viele Menschen buchstäblich auf der Straße bleiben. Damit muss sich das ganze Land auseinandersetzen. Wir sitzen hier im Nordosten der USA, in Massachusetts, vielleicht ein wenig in einem Elfenbeinturm, wo man nicht unbedingt gleich die Probleme von Louisiana, Kentucky oder Missouri erkennt. Auch in dieser Hinsicht war der Wahlkampf hilfreich.
Wie gespalten ist die US-Gesellschaft tatsächlich?
Die Medien und die Wahlkampfveranstaltungen vermitteln dieses Bild. Aber vielleicht ist es gar nicht so dramatisch. Die Polarisierung bestand ja schon vor dem Wahlkampf und wurde uns durch diesen jetzt nur vorgeführt. Und vielleicht war das notwendig, um eine Diskussion zu ermöglichen und diese Polarisierung zu überwinden. Denn egal, welcher Kandidat gewinnt: Er muss sich mit der anderen Seite und mit der Realität auseinandersetzen, die zu dieser Situation geführt hat.
Hat sich an Ihren Arbeitsbedingungen etwas verändert?
Nein, die sind nach wie vor sehr gut. Ich operiere zum Beispiel am Freitag, und am Montag stehe ich im Labor. Dieses Wechselspiel ist optimal, und ist ja auch in Österreich an den Medizin-Unis bereits möglich. Wir haben hier in Massachusetts eine multikulturelle Community an Forschern aus zahlreichen Ländern, die sehr gut zusammenarbeiten. Daran wird sich auch nichts ändern. Letztendlich ist der Optimismus hier nach wie vor ungebrochen. Es ist frustrierend, dass Donald Trump sehr auf einer Pessimismuswelle geschwommen ist, die aber unproduktiv für das Land ist: Es geht ja nicht darum, wie schlecht es uns geht, sondern darum, wie man die Dinge besser machen kann. Das war immer der Grundtenor in den USA – und ich hoffe, dass der erhalten bleibt.
Zur Person
Der Tiroler Harald C. Ott, 39, studierte von 1995 bis 2000 an der Medizinischen Fakultät der Uni Innsbruck (heute: MedUni Innsbruck). Anschließend begann er seine Fachausbildung zum Thoraxchirurgen (Thorax bedeutet Brustkorb) an der Uni-Klinik für Chirurgie in Innsbruck, ehe er 2004 in die USA an die University of Minnesota wechselte.
Seit 2006 ist er Thoraxchirurg am Massachussetts General Hospital der Harvard Medical School in Boston und leitet das „Ott Lab“, dessen Schwerpunkt die Ent- wicklung von Kunst-Organen ist.
Österreich ist beim Thema Transplantationen zwar international im Spitzenfeld – aber auch bei uns gibt es Wartelisten. 2015 wurden 787 Organtransplantationen durchgeführt, 720 mit Organen von Verstorbenen, 67 stammten von Lebendspendern, so der „Transplant-Jahresbericht 2015“ des Österreichischen Bundesinstituts für Gesundheitswesen.
Während man auf eine Niere im Mittel 41,6 Monate wartet (hier gibt es auch die Möglichkeit der Dialyse als Nierenersatztherapie), liegen die Wartezeiten bei Herztransplantationen bei 3,7 Monaten, bei der Lunge und bei Lebertransplantationen bei 3,2 Monaten. Erfreulich: Die Wartezeiten haben sich bei Niere, Herz und Leber geringfügig verkürzt, für Lungentransplantationen sind sie gleich geblieben.
Insgesamt nahm die Zahl der Menschen, die auf ein Organ warten (siehe Grafik), im Vorjahr um zehn Prozent ab. Das liegt auch an den Fortschritten bei der Behandlung chronischer Erkrankungen, die zum Versagen von Organen führen können. Trotzdem sterben noch immer Menschen auf den Wartelisten für Organtransplantationen.
Kommentare