"Entwicklungsturbo": Wie man Ängste für sich nützen kann

Angst ist besser als ihr Ruf, meint die Wiener Psychiaterin Constanze Dennig. In ihrem neuen Buch geht es nicht darum, wie man Ängste am besten loswird, sondern wie man sie versteht und zu nützen weiß. Der KURIER traf Dennig zum Gespräch.
KURIER: Frau Dennig, was ist Angst eigentlich?
Constanze Dennig: Angst entsteht, wenn ein Reiz dem Gehirn Lebensgefahr vermittelt, auch wenn das eigentlich nicht stimmt. Es kommt zu Herzrasen, Zittern, Schweißausbrüchen und psychischer Erregung. Das Problem ist, dass meist überhaupt keine Lebensgefahr besteht. Anders als das Tier fürchtet sich der Mensch auch vor Dingen, die nicht ad hoc stattfinden, und versucht, Strategien zu finden, um ihr Eintreten zu verhindern. Das hat unser Überleben gesichert und war ein Entwicklungsbooster für die Menschheit. Unsere Kultur, Religionen, alles beruht auf der Prämisse, irgendetwas Schlimmes zu verhindern.
Warum kommt Religion dabei große Bedeutung zu?
In dem Augenblick, wo ich die Kontrolle an jemanden delegiere, etwa einen Gott, den ich bitten kann, dass er alles für mich gut macht, bin ich zu einem Teil angstbefreit, vor allem, wenn er das Problem des Todes lösen kann. Die Todesangst ist unsere bestimmende Angst. Alle Kulturen schaffen sich eine Religion, die verhindert, dass es nach dem Tod aus ist. Selbst der beste Wissenschaftler hat magisches Denken, auch wenn er nicht religiös ist. Es gibt dann andere Strategien, damit umzugehen, etwa sich zu sagen, ich lebe im Moment, wer weiß, was morgen ist. Nur ist es immer ein Versuch, diese Angst nicht zuzulassen.
Warum ist die Todesangst so eine Urangst?
Die Todesangst ist eine Furcht vor dem Ungewissen und eine Angst vor dem Ich-Verlust, weil alles, was mich ausmacht, dann weg ist. Wir wissen ja nicht, was danach kommt. Aber die Erfindungskraft des Menschen hat sich nach dem Tod ein Jenseits geschaffen, wo es einem entweder gut oder schlecht geht, was natürlich eine große Machtbefugnis der Menschen ist, die das bestimmen. Problematisch wird es, wenn mit der Angst Geschäfte gemacht werden und Menschen in eine Abhängigkeit geraten, wie das im Bereich der Esoterik oft der Fall ist.
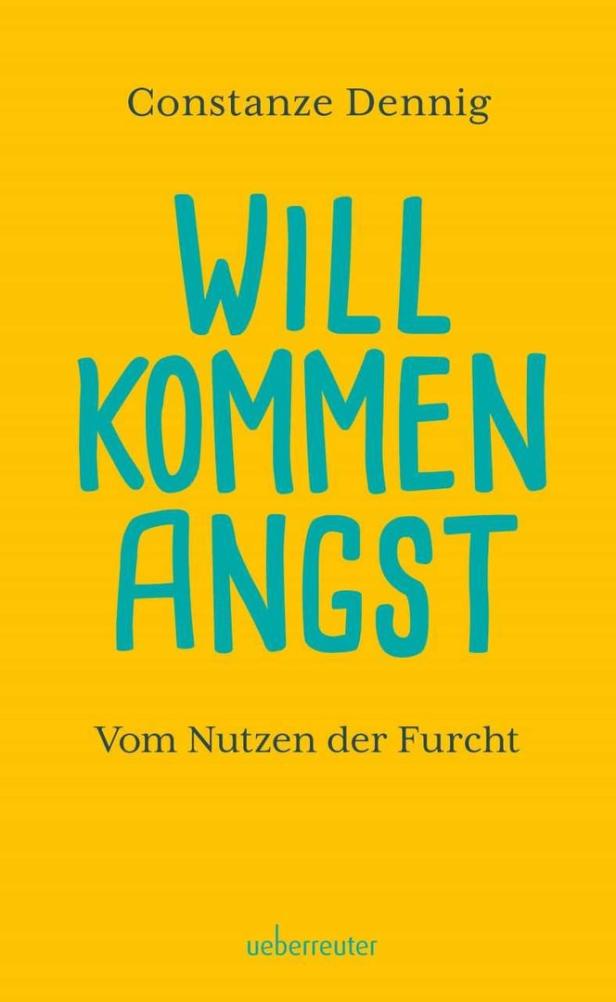
Constanze Dennig: WWillkommen Angst. Vom Nutzen der Furcht." Ueberreuter Verlag. 160 Seiten. 25,00 Euro
Gerade in der Pandemie haben sich hier viele zugewandt. Haben Sie einen Anstieg bei Ängsten bemerkt?
Was Corona und jetzt auch der Ukraine-Krieg bewirken, ist, dass die Menschen ein viel größeres Bewusstsein für Ängste haben und eher dazu tendieren, Ängste, die sie immer schon hatten, aber mit denen sie gut zurechtgekommen sind, jetzt plötzlich einzuordnen und eine Ursache dafür zu finden. Das ist für den Einzelnen sehr vorteilhaft, weil ich die Ursache nach außen verschieben kann und nicht in mir selber suchen muss. Durch die Lockdowns hatten viele mehr Zeit zu grübeln. Das Gehirn ist kein Multitasker, sondern braucht Muße, um Angst zu haben. Besonders bei Jugendlichen hat man das bemerkt, da sie zusätzlich zum hormonellen Chaos dieses Alters Zeit hatten, sich in der Grübelnische zu verstecken.
Welche Ängste müssen behandelt werden?
Der Unterschied ist immer, ob sie die Lebensqualität beeinträchtigen. Es ist das Ausmaß, die Dauer und wie ich damit fertig werde. Solange eine Angst jemanden selbst oder andere nicht beeinträchtigt, würde ich als Psychiaterin das nicht als Krankheit werten. Viele Ängste treten auch spontan auf, dann vergeht eine gewisse Zeit und plötzlich ist diese Angst durch ein anderes Ereignis, das kann auch eine andere Angst sein, überlagert. Dass man komplett angstfrei ist, wird nicht stattfinden. Angst ist aber auch ein Entwicklungsturbo, Zündstoff für unsere Kreativität, unser Glück.
Etwa bei kollektiven Katastrophen wie der Pandemie oder dem Ukraine-Krieg.
Es ist immer die Frage, wie ich mit einer Angst umgehe, sowohl als Gesellschaft als auch als Einzelner. Die Pandemie hat etwa einen wissenschaftlichen Booster geschaffen, die Entwicklung der RNA-Impfung hätte nie so schnell stattgefunden. Aber solche Katastrophen machen Druck, ihre Ursache zu bekämpfen. Auch der Ukraine-Krieg hat etwas bewirkt, nämlich eine Solidarität von europäischen Staaten – ob es so bleibt, ist eine andere Frage, aber die Aufgabe war, unser Energieproblem zu lösen und zu verhindern, dass wir auch überfallen werden. Diese gesellschaftliche Übereinkunft hätte ohne den Krieg nicht stattgefunden. Und es hat bewirkt, dass ein Umdenken in Bezug auf eine ökologische Energiegewinnung stattgefunden hat. Die Angst ist auch ein Antrieb für Innovation.
Dennoch gelten Ängste als Zeichen von Schwäche.
Es ist für den Einzelnen wichtig, zu erleben, dass er mit seinen Ängsten fertig wird. Denn das macht glücklich. Ich glaube, das beginnt schon bei Zweijährigen am Spielplatz. Ich muss ein Kind, das Angst hat wo raufzuklettern, nicht raufheben, sondern dann kann es eben nicht raufklettern. Wenn ich Kindern und Jugendlichen alles abnehme, entmündige ich sie und nehme ihnen auch die Chance zum Glück. Kinder, die sich nie überwinden müssen, werden keine Widerstandskraft entwickeln. Das ist genau das, was Erziehung machen sollte: Wenn schon das kleine Kind lernt, ja, ich fürchte mich, aber ich weiß, ich schaffe es.
Kommentare