Medizinethiker: "Pessimist zu sein, ist das Schlechteste überhaupt"

Was wird das neue Jahr bringen? „Ich vertraue darauf, dass die Zukunft Sinn macht“, sagt der Medizinethiker Giovanni Maio.
„Ein gutes neues Jahr!“ – diesen Satz schreibt man routiniert in die traditionellen Neujahrswünsche, der Glaube daran fehlt aber offenbar vielen: 57 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher blicken pessimistisch in die Zukunft, ergab die KURIER-Regionalumfrage in Zusammenarbeit mit OGM. Der Arzt, Philosoph und Medizinethiker Giovanni Maio kann einer solchen negativen Haltung nichts abgewinnen. Er hat sich intensiv mit dem Thema „Hoffnung“ beschäftigt (siehe unten) und sagt: „Hoffnung ist die Bereitschaft, die Zukunft anzunehmen“.
KURIER: Ich nehme an, Sie sind kein Pessimist?
Giovanni Maio: Auf keinen Fall! Pessimist zu sein, ist das Schlechteste überhaupt. Dann können Sie die Hände in den Schoß legen und alles für verloren erklären, obwohl das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Der Pessimist rechnet mit dem Schlimmsten und setzt sich deshalb nicht mehr für das Gute ein. Das ist der Fehler des Pessimismus.
Also sind Sie Optimist?
Nein, das bin ich auch nicht. Der Optimist sagt sinngemäß, es wird schon alles gut werden, mach dir keine Sorgen – und blendet einen möglichen schlechten Ausgang der Zukunft aus, er möchte damit nichts zu tun haben. Das ist einseitig.
Der hoffende Mensch sieht einerseits die Gefahren, er weiß aber auch: Die Zukunft ist offen. Damit etwas gut wird, müssen wir etwas beitragen, uns dafür einsetzen. Unsere Sprache kennt die Formulierung „zwischen Hoffen und Bangen“. Ich bange – und ich hoffe. Ich vertraue darauf, dass die Zukunft Sinn macht und ich sie auch unter widrigen Umständen bewältigen kann.

Medizinethiker Giovanni Maio: „Ich bange – und ich hoffe.“
Sie sind trotz düsterer Prognosen hoffnungsvoll?
Ja, ich schaue hoffnungsvoll in das neue Jahr. Ein Kennzeichen unserer Zeit ist: Wir erschrecken derzeit vor den Widrigkeiten der Gegenwart – den Kriegen, der Not vieler Menschen, den wirtschaftlichen Problemen, den Folgen der Erderwärmung. Aber all diese Entwicklungen sollten ein Impuls sein, für das Gute zu kämpfen.
Hoffnung zu haben bedeutet, sich auf die Zukunft einzulassen. Sie ist immer mit einer klaren, realistischen Sicht auf die Welt und mit einer Motivation, zur positiven Entwicklung etwas beizutragen, verbunden.
Giovanni Maio ist Internist, Philosoph und Professor für Medizinethik an der Universität Freiburg in Deutschland. Er publiziert viel zum Thema „Hoffnung und die Medizin“: „Jeder Mensch kann in jeder Situation seines Lebens einen Grund zur Hoffnung finden.“
Viele Menschen sind aber von den vielen schlechten Nachrichten entmutigt. Sie selbst schreiben, wir haben verlernt, zu hoffen.
Ja, weil viele davon überzeugt sind, die Zukunft steht sowieso schon fest, alles nimmt seinen Lauf. Und weil wir denken, wir können ohnehin nichts ändern, lähmen wir uns und ergeben uns in einen Fatalismus: Es komme sowieso, wie es kommt. Aber das ist grundlegend falsch. Der hoffende Mensch ist nicht der Schicksalsergebene. Er ist die Person, die von sich aus sagt, ich möchte etwas beitragen zu einer guten Zukunft.
Die Hoffnung ist die Grundlage dafür, dass Menschen etwas tun, um etwas ringen. Hoffen heißt, eine Chance in der Zukunft zu sehen, eine Chance, dass sich Dinge doch auch zum Guten wenden können.
Aber da werden Ihnen viele antworten: Ja, vielleicht können z. B. Politiker etwas beitragen, aber was kann ich alleine schon bewirken?
Die Zukunft gestalten wir alle gemeinsam, wir sind ihr nicht ausgeliefert. Jeder kann sich im Kleinen für Frieden einsetzen, etwa mit unserer Sprache, dass wir nicht ausgrenzen und polarisieren, sondern diese Ausrichtung auf das Gemeinsame vorleben. Der hoffende Mensch ist nicht verbissen, aber kämpferisch – in dem Sinne, dass er beharrlich in seinen Überzeugungen ist, über den Tag hinausdenkt, Geduld hat und sich nicht beirren lässt.
Hoffen heißt, eine Chance in der Zukunft zu sehen, eine Chance, dass sich Dinge doch auch zum Guten wenden können.
Viele schauen heute nur auf das Jetzt und vergessen dabei, dass eine Situation – sei es in der Politik oder der Wirtschaft – in ein, zwei Jahren ganz anders sein kann. Derjenige, der nicht hofft, glaubt hingegen schon zu wissen, was sein wird. Aber dem ist nicht so.
Aber ist das alles nicht ein wenig wirklichkeitsfremd?
Der Hoffende verbindet den klaren Blick für die Wirklichkeit mit einem Sinn für die Möglichkeit. Er ist kein verklärender Mensch. Der Hoffende gibt sich nicht einer naiven Illusion und Wunschträumen hin. Er weiß ganz genau, es kann eine Sache zunächst auch schlecht ausgehen. Aber er weiß auch, selbst im Widrigen wird nicht alles sinnlos.
Selbst wenn eine Sache nicht gut ausgeht, ist dennoch nicht alles verloren. Auch im Widrigen bleibt etwas Gutes erhalten. Der Hoffende vertraut darauf, die innere Stärke zu haben, nicht an der Zukunft zu zerbrechen, sondern sie zu bewältigen – auch dann, wenn es Rückschläge gibt.
Sie sind Spezialist für Medizinethik. Ein krebskranker Mensch hofft auf Heilung. Doch dann stellt sich heraus, seine Erkrankung ist unheilbar. Ist es nicht schwer, in so einer Diagnose etwas Gutes zu sehen?
Wir versteifen uns heute oft auf eine bestimmte Sicht: „Der Krebs muss geheilt werden, sonst ist nichts gut.“ Das stimmt nicht. In einer sehr technisch orientierten Medizin herrscht oft ein solch einseitiges Verständnis von Hoffnung: Den Patienten wird suggeriert, es wird schon alles gut werden, die Therapie wird schon wirken. Und wenn sie nicht wirkt? Dann verzweifelt der Patient.
Das richtige Verständnis von Hoffnung bedeutet: Nicht die Menschen auf etwas vertrösten, was sich vielleicht nie ereignen wird, wie die Heilung. Sondern aufzuzeigen: Selbst dann, wenn die Therapie nicht anschlagen sollte, wäre nicht alles verloren.
Und wie kann das vermittelt werden?
Über Zuwendung. Indem das betreuende Gesundheitspersonal sagt: Wir begleiten dich dabei, mit deiner Krankheit zu leben, wir kümmern uns um dich, und du kannst nach wie vor eine gute Zeit haben. Zu wissen, dass man nicht allein gelassen wird, das ist hoffnungsstiftend.
Aber die Ökonomisierung der Medizin führt dazu, dass die dafür notwendige Zeit häufig dem Effizienz- und Rentabilitätsdenken geopfert wird. Dann aber fühlen sich die Menschen im Stich gelassen und verzweifeln.
Ist das nicht generell ein Problem, dass sich viele Menschen allein gelassen fühlen, einsam sind oder sich zurückziehen?
Ja, und wer sich zurückzieht, sich isoliert, sich vielleicht in virtuelle Welten flüchtet, der kommt leicht in eine Negativspirale, in der er nur Bestätigungen für seine negative Sicht auf die Welt findet. Hoffnung entsteht aber vor allem aus Beziehungen zu anderen Menschen, aus einem umsichtigen Umgang miteinander.
Zu wissen, dass man nicht allein gelassen wird, das ist hoffnungsstiftend.
In jedem Gespräch, in dem wir eine tiefe Achtung vor dem anderen zum Ausdruck bringen, können wir ein Hoffnungslicht anzünden: Die Hoffnung, dass wir gemeinsam die Zukunft gestalten werden. Solange Menschen im guten Gespräch mit anderen Menschen sind, haben wir Grund zur Hoffnung.
Buchtipp
In dem von Maio herausgegebenen Sammelband „Hoffnung“ zeigen Ärzte, Theologen und Philosophen auf, wie Menschen in schwierigen Situationen Hoffnung als Kraftquelle erfahren können.
Giovanni Maio (Herausgeber): „Hoffnung. Systemische Analyse und praktische Relevanz.“ Herder, 352 Seiten, 28 Euro
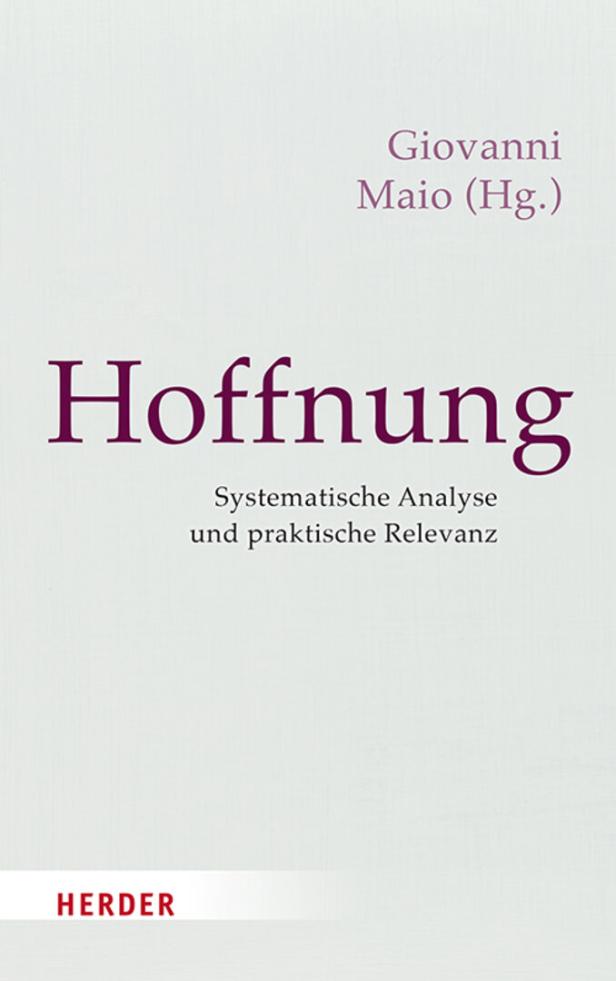
Kommentare